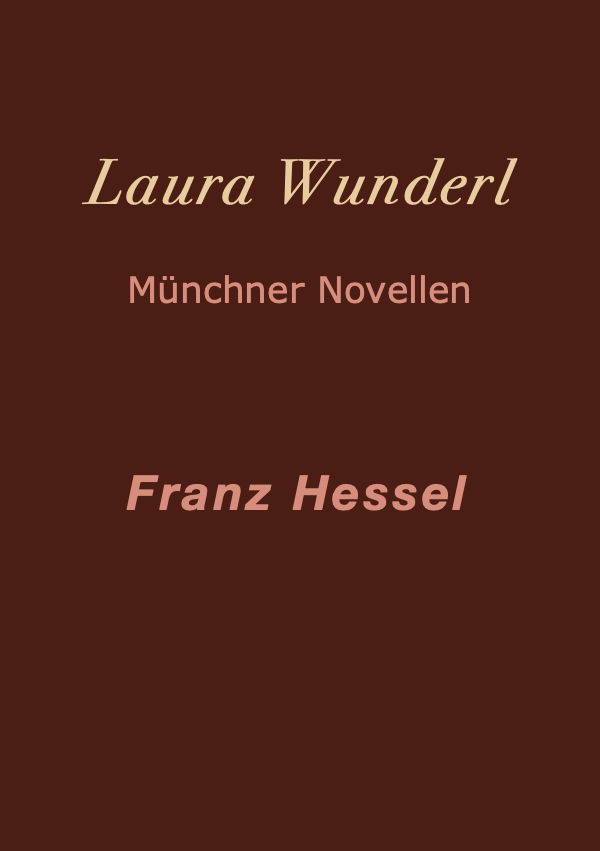
* A Distributed Proofreaders Canada eBook *
This eBook is made available at no cost and with very few restrictions. These restrictions apply only if (1) you make a change in the eBook (other than alteration for different display devices), or (2) you are making commercial use of the eBook. If either of these conditions applies, please contact a https://www.fadedpage.com administrator before proceeding. Thousands more FREE eBooks are available at https://www.fadedpage.com.
This work is in the Canadian public domain, but may be under copyright in some countries. If you live outside Canada, check your country's copyright laws. IF THE BOOK IS UNDER COPYRIGHT IN YOUR COUNTRY, DO NOT DOWNLOAD OR REDISTRIBUTE THIS FILE.
Title: Laura Wunderl: Münchner Novellen
Date of first publication: 1908
Author: Franz Hessel (1880-1941)
Date first posted: October 18, 2025
Date last updated: October 18, 2025
Faded Page eBook #20251024
This eBook was produced by: Delphine Lettau, Howard Ross & the online Distributed Proofreaders Canada team at https://www.pgdpcanada.net
This file was produced from images generously made available by Internet Archive.
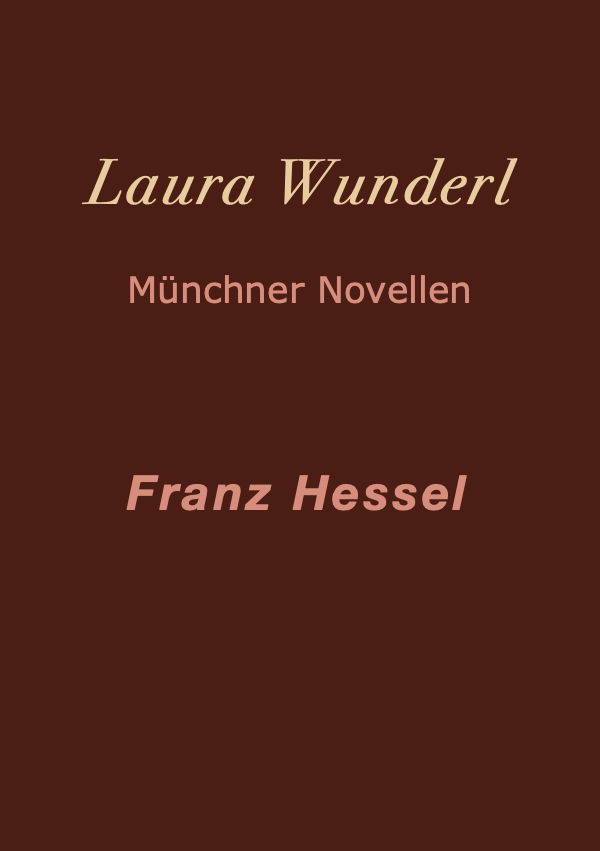
Laura Wunderl
Münchner Novellen
von
Franz Hessel
S. Fischer, Verlag, Berlin
1908
Alle Rechte,
insbesondere das der Übersetzung,
vorbehalten.
| Laura Wunderl | Seite | 9 |
| Das Fest der Maria | „ | 79 |
| Peterchen | „ | 111 |
| Die Radlampe | „ | 149 |
Als ich ein junger Student im ersten Semester war, sagten die anderen, die schon länger in München lebten, immer, ich müßte den Mädchen nachgehen: das gehörte sich nun einmal.
Sogar mein Kolleg-Nachbar, ein ernster Jüngling und Vorsitzender einer wissenschaftlichen Verbindung mit künstlerischen Interessen riet mir zu. Er hatte sich früher auch nicht um das andere Geschlecht gekümmert. Aber da wäre er einmal ins Gärtnerplatz-Theater gegangen: Wie er seinen Mantel in der Garderobe abgab, stand ein Mädchen neben ihm und legte auch ab. Da fragte die Garderobiere: „Bitt’ schön, die Sachen gehören zusammen, nicht wahr, da brauch ich bloß eine Nummer zu geben?“ Ach nein, das Fräulein gehörte nicht zu ihm. Und als er dann oben in seine Bankreihe wollte, fragte der Logenschließer verwundert: „Ist der Herr allein?“ — Und da saßen denn auch ringsum lauter Pärchen, man mußte sich schämen allein zu sein.
„Na, und dann?“ fragte ich.
Ja, jetzt hätte er etwas sehr Nettes gefunden; er nahm seinen Kneifer ab und putzte ihn lächelnd.
Auch mein Freund Eduard Wedel, der ein Dichter war und an einer rein philosophischen Doktor-Dissertation arbeitete, ließ mir keine Ruh’. „Du mußt das Münchner Mädel kennen lernen. Wenn du dich nicht beeilst, stirbt es inzwischen aus.“ Er konnte meine „unverantwortliche Lebensträgheit“ schließlich nicht mehr mit ansehen und bestand darauf, mich mit einer kleinen Nähterin zusammen zu bringen, die er schon etwas lange kannte.
Also gingen wir eines Abends um zehn Uhr die Sonnenstraße hinauf und vor das Volkstheater, auf das Münchner Mädchen zu warten, das da drin den „Pfarrer von Kirchfeld“ sah.
Wir kamen gerad zum Schluß der Vorstellung zurecht. Da strömten sie in Menge heraus, manche eilig und allein, im Kopftuch und grauen Mantel, andere langsam im garnierten Hut und modernen Jackett am Arm des Freundes.
„Da ist das Kätchen,“ sagte Wedel und begrüßte ein Persönchen, das schüchtern unter einer Pelzmütze hervorsah. Sie gab ihm den einen Arm und ließ mir den andern, und wir gingen ins Café.
Dort nahm mich Wedel nach einiger Zeit beiseite und sagte: wenn mir das Kätchen gefiele, so sollte ich sie jetzt beide noch zu mir zum Tee einladen; er wollte dann schon im rechten Moment verschwinden.
Also gingen wir noch zu mir hinauf, tranken Tee und rauchten Zigaretten. Wedel erzählte die ungeheuerlichsten Geschichten; und das Kätchen gab sich Mühe, nicht alles zu glauben. Aber als er fort wollte, bestand sie darauf, wir müßten ihn begleiten.
Und wie wir vor seiner Tür waren, wollte sie gleich mit hinauf. Er sagte: „Ich bin noch nicht müde, wir bringen den Fritz noch heim.“ Dann ging’s wieder bis zu mir zurück. Wedel reichte mir rasch die Hand und wollte davon. Da streckte sie flugs ihre dazu. Und ich — ging allein meine vier Stiegen hinauf.
Aber mein Freund war nicht von seinen kupplerischen Vorsätzen abzubringen: Er lud mich zwei Tage später mit dem Kätchen zum Abendbrot ein, setzte uns nebeneinander auf den Diwan und sagte immer: „Ihr jungen Leute“ und „wie gut ihr zusammen paßt“ und dergleichen.
Kätchen gewährte mir dann ein Stelldichein.
Das erste Mal versetzte sie mich allerdings, und ich stand am Karlstor eine Stunde ohne Schirm im Regen. Viele hübsche Mädchen gingen vorbei und sahen sich nach mir um.
Den andern Morgen bekam ich einen Brief: ich sollte entschuldigen. Sie wäre von einer Freundin „in Beschlag genommen worden“ und käme heut zum gleichen Stelldichein, „wenn dem Herrn paßte“.
Diesmal nahm ich einen Schirm mit, aber es regnete nicht.
Kätchen ließ nicht lange auf sich warten und wir gingen in die Blumensäle.
Wir waren sehr früh da. Während der ersten Musikstücke aßen wir Gulasch und tranken Bier. Als Kätchen mit essen fertig war, fuhr sie sich mit dem Rücken der rechten Hand gelinde über den Mund. Sie hatte zwar eine Serviette im Schoß, aber darauf lagen die Geldbörse, der Hausschlüssel und die Handschuhe. Und die linke Hand hatte sie doch mir gegeben, ein wackeres braunes Händchen; ich streichelte es, wie sich’s ziemt, und kam dabei ans Handgelenk: da fühlte ich einen Pulswärmer. Das arme Kind. Nähterinnen müssen immer stillsitzen und frieren, „aber die Liebe hält warm,“ meinte Kätchen, als ich sie bedauerte.
Das war so um halb zehn Uhr herum. Die Vorstellung dauerte dann noch bis Elf und den Kinematographen zuletzt wollte Kätchen nicht schenken. Auf dem Heimweg erzählte sie, daß der Herr vis-à-vis ein paarmal versucht hätte, unterm Tisch mit ihr zu fußeln. Das wäre empörend, wo sie doch jetzt mit mir ginge. Ich fand es auch empörend. Sonst sprachen wir unterwegs nicht viel.
In meinem Zimmer fand sich ein großes Postpaket auf dem Tisch. Es kam von zu Hause, ich machte auf, es waren Kuchen darin. Davon sollte nun das Kätchen essen, während ich neben ihr saß und an ihrer Taille knöpfte. Aber wir kamen beide nicht recht von der Stelle. Sie futterte wie ein Vögelchen, und ich wurde aus ihren Haken, Ösen und Bändern nicht klug. Dann fing sie noch ein bißchen an zu weinen: „Heut den, morgen den“ schluchzte sie, ich bin ein schlechtes Mädchen — aber wenn man nicht das bißchen Liebe hätt’, meinte sie schließlich und zog die Pulswärmer ab.
Ich hatte inzwischen im Dunkeln gebückt mit meinen Hosenträgern und Schnürriemen zu tun. Als sie das von der Liebe sagte, richtete ich mich auf und zeigte auf das offene Bett, das gleichgültig in seiner Ecke stand.
Das Kätchen tauchte aus einer Hülse von buntem und weißem Unterzeug, die mitten im Zimmer stehen blieb, sah über die Schulter nach mir zurück und sagte „Ich bin so frei“ . . . .
Ich träumte schrecklich viel in dieser Nacht und wachte alle Stunden auf, dann lag neben mir das fremde Mädchen in wirrem Haar und mit offenem Munde. Ich träumte von meinem Vater: er kam mir aufzuhelfen; denn ich lag in einer nassen kalten Erde und konnte nicht heraus. Und drüben spielten die kleinen Freundinnen meiner Schulzeit in weißen Kleidchen und schwarzen Strümpfen Ball und wußten nicht, daß ich unter ihnen in der schwarzen Erde vergraben lag. Eine Uhr schlug: die Kinder hielten im Spiel ein.
Vom siebenten Schlag der Uhr wachte ich auf. Es war der Regulator überm Sofa, zwischen den Öldrucken König Ludwigs und des Trompeters von Säkkingen. Kätchen war schon aufgestanden und wusch sich, weil sie zur Arbeit mußte.
Als sie mir dann den Abschiedskuß gab, hätte ich ihr gern wenigstens einen Kaffee gekocht. Aber sie war gleich zur Tür hinaus. Wie ihre Pelzmütze verschwand, hatte ich sie, glaube ich, einen Augenblick wirklich lieb.
Aber mir ist nichts von ihr geblieben, als vier Haarnadeln auf dem Tisch, eine braune Flocke in meinem Kamm und das Schnupftuch im Sofawinkel.
Ich habe das Kätchen dann nicht wieder gesehen. Sie ließ mich durch Wedel ersuchen, ihr Schnupftuch zu „remittieren“. Ich „remittierte“ es.
Meine Freunde machten noch einige Versuche, mich mit Mädchen zusammen zu bringen, aber vergebens. Ich war vormittags in der Universität und am Nachmittag lief ich brav mit einem Buch in der Hand im Englischen Garten und Isartal herum. So verging der Herbst. Dann kam die Konzert- und Theaterzeit. Ich saß oben im vierten Rang der Oper neben den Musikschülerinnen, die die Augen schlossen, um Tristan in sich aufzunehmen. Ich saß im Odeon neben den blondgezöpften Malerinnen und hörte Symphonieen. Aber ich machte keine Bekanntschaft.
Da begab es sich, daß ich eines Nachmittags bei trostlosem Winterregen allein in meinem Zimmer war, mochte nichts lesen noch studieren und langweilte mich. Da nahm ich meinen Schirm und lief in den Regen hinaus. Ich ging am Café vorbei: drinnen waren Bekannte. Aber ich hatte keine Lust, mich zu ihnen zu setzen.
Ich ging traurig weiter in die Stadt hinein. Den Schirm hielt ich dicht vors Gesicht, weil es schief regnete, und sah von meinen Mitmenschen nur die Beine. Am Stachuseck drehte mir der scharfe Wind den Schirm nach rechts. Und ehe ich ihn wieder zurückgedreht hatte, stand ein Mädchen vor mir, das ich ansehen mußte.
Sie hatte einen Strohhut auf, mit einer dicken Kirschengarnitur, ließ sich den Regen gefallen und lächelte alle Leute vergnügt an, wie ein Kind, das zum ersten Mal auf die Straße kommt.
Als sie mich und meinen schiefen Schirm ansah, mußten wir beide lachen und ich fragte: „Wohin geht’s, Fräulein?“
Sie: „Immer grad aus, bis es ums Eck geht.“
„Und an der Ecke?“
„Bleibt man stehn, ob schöne Leut’ kommen.“
Ob wir zusammen weiterspazieren wollten?
„Recht gern.“
Ob wir ins Café hinterm Tor wollten?
„Ei warum nicht!“
Am Fenster saßen ein paar sehr Aufgetakelte, die sahen sich nach mir und der Kleinen mit dem Kirschenhut um, als wir durchs Lokal gingen.
„Denen bin ich nicht recht,“ meinte sie, „sie sind mächtig hergerichtet und nun verdrießt sie’s, daß ich in meinem braunen Kittel ihnen den feinen Herrn vor der Nase weggefischt habe.“
Aha, dachte ich, du bist an eine berufliche geraten. Aber zu meiner Verwunderung gefiels mir recht gut neben ihr. Und als wir unsern Kaffee ausgetrunken hatten, fragte ich: „Wie heißt du denn?“
„Laura.“
„Ein hübscher Name.“
„Und du?“
„Fritz.“
„Wo wohnst du denn, Laura?“
„Im Sterneck.“
„Wollen wir einen Wagen nehmen?“
„Nein, Fritz, wir spazieren hübsch unter deinem Regenschirm.“
Aber den brauchte ich gar nicht aufzuspannen. Die Sonne schien, es tropfte von den Dächern und ein Flaschenscherben auf dem Fahrdamm spielte lustig in allen sieben Regenbogenfarben.
Wir kamen in die Sendlingerstraße, und blieben vor einem alten Giebelhaus stehen. Es ging eine steile Holzstiege mit geschnitztem Geländer hinauf in ein dunkles, breites Treppenhaus.
Im obersten Stockwerk zog die Laura an einer Schelle. Da kam mit einem Licht ein altes Weibchen in der Haube heraus:
„Nur leis’ die Herrschaft, nur leis’. Bitte derweil einen Augenblick in die Küche zu treten. Im Zimmer wärs noch nicht gerichtet.“
„Was hast du denn im Zimmer, Mutter Milly?“
„Ich habe deine Wäsch’ ausgeflickt, du lässigs Kind. Komm, hilf mir einräumen. Einen Augenblick, die Herrschaft.“
Ganz winzig war die Küche. Auf dem grünen Fensterbrett standen Blumentöpfe. Ein Kätzchen hockte am Herd. Ich setzte mich auf den Küchentisch, zwischen ein großes Bauernbrot und den Kirschenhut, den Laura abgelegt hatte, und wartete.
Nach einer Weile streckte die Kleine ihre Hand durch die Tür und zog mich in ihr Zimmer. Da rochs ganz ländlich nach Holz und Leinen, der Schrank stand noch offen: lauter weiße Hemden mit roter Stickerei lagen darin. Auf dem Tisch stand ein grüner Milchkrug und daneben ein großes Glas mit welken Herbstblumen.
„Gefällts dir bei der Laura Wunderl?“
„Wunderl?“
„Ja, Wunderl.“
Sie machte ihr Haar auf, in zwei lichten Zöpfen fiel es lang herunter.
Ach, mir gefiels nur gar zu gut.
Dem Hemd der Laura war vorn auf der Brust ein T. und ein W. aufgestickt.
„Das ist von meiner Mutter Theres,“ sagte sie.
Da küßte ich beide, das T. und das W. und bekam zum Lohn auch so ein Wunderl-Hemd angezogen.
Wir tranken zweimal aus dem grünen Krug; und so gut hat mir noch keine Milch geschmeckt.
Beim Abschied standen ihr Tränen in den Augen. Warum sie weinte, fragte ich.
„Ach, das ist schwer zu sagen,“ antwortete die Laura und lachte wieder.
Den spätern Abend dann saß ich allein zu Haus und konnte vor lauter Staunen nichts essen und nichts lesen. Ich lag in meinem Bette wach und kam auf keinen rechten Gedanken.
Und die ganze nächste Zeit kam mir dieser Abend nicht aus dem Sinn. Ich hatte ihr doch einen Taler gegeben und morgen gab ihr ein anderer den Taler und gestern war’s wieder ein anderer. Man konnte doch eigentlich so eine nicht lieben. Mitleid hatte ich aber auch gar keins mit ihr. Ich nahm mir vor, sie nicht wiederzusehen.
Nun studierte ich wieder eine Weile. Aber dann kam der Karneval. Da es mir auf den großen Redouten nicht recht gefallen wollte, schickten mich die guten Freunde, die durchaus ein „Erlebnis“ von mir beanspruchten, eines Abends auf den Kindl-Keller-Ball.
Zuerst langweilte ich mich sehr. Die Zigeunerinnen und die Türkinnen, das Gänseliesel und die Königin der Nacht tanzten jede am liebsten mit ihrem Schatz. Und als ich endlich eine zur Française erwischte, hatte sie einen Vetter im Visavis.
Die Française wurde sehr regelrecht getanzt. Die „Herren“ im schwarzen Sonntagsrock sahen sogar beim Dreher aus wie Leute, die ihre Pflicht erfüllen. Und rings an den Wänden saßen die Mütter und schürten ihre knallroten Backen mit den Fächern, die ihre Töchter ihnen während des Tanzes anvertraut hatten. Auch von den Müttern waren manche kostümiert.
Ich war schon im Begriff wegzugehen. Da sagte im Gedränge an der Tür ein Domino zu mir: „Langweilst du dich auch so schrecklich?“
Sie hatte braune Augen unter der Maske und rabenschwarzes Haar.
„Jetzt wirds schon besser,“ sagte ich und tanzte gleich mit ihr zweimal im Saal herum.
„Du bist ein Student und aus Norddeutschland,“ meinte sie dann.
„Und du bist eine Münchnerin.“
„O nein, ich bin aus Augsburg, und meine Familie stammt aus Italien.“
Nun sah ich, daß sie bräunliche Arme und Schultern hatte, und sagte einiges auf Italienisch. Sie verbesserte mich und folgte meiner Einladung in eine Loge, wo wir einen sehr schlechten Asti Spumante tranken.
Als die Flasche leer war, sagte sie mir ihren Vornamen: Nina, und ich nahm ihr die Maske ab und küßte sie. Sie war aber mit meinem Kuß gar nicht zufrieden und schüttelte den Kopf.
„So einfach ist das nicht,“ sagte sie, legte mir die Arme um den Hals und küßte mich sehr sorgsam und eindringlich.
„Wie kommst du eigentlich hierher, Nina?“
„Daran ist der gute Thomas schuld. Hätt’ er mir beim Abschied nicht expreß gesagt, ich sollt’ mit dem Karneval auf ihn warten, so wär ich heut am Ende hübsch zu Hause geblieben.“
„Wer ist denn der gute Thomas?“
„Der gute Thomas ist wirklich ein sehr guter Mann. Ich kenn ihn schon von zu Hause. Er ist Kaufmann und hat mich hier auf die Handelsschule gebracht. Wenn ich die doppelte Buchführung gelernt habe, dann können wir heiraten, meint er. — Ich hab ihn heut früh zur Bahn begleitet. Er macht eine Geschäftsreise. Unterwegs hat er mir gute Lehren gegeben. Vom Ernst des Lebens hat er gesprochen und von den magern Jahren, wenn der Mann krank ist und die Kinder groß werden. Er liebt mich sehr, zuletzt hat er mir drei Küsse gegeben: zwei aus Freundschaft auf die Wangen und dann einen aus Liebe auf den Mund — lach nicht, er küßt vielleicht besser als du.“
„Und dann bist du doch noch am selben Abend tanzen gegangen!“
„Das verstehst du noch nicht, Fritzchen,“ sagte sie und streichelte meine Hand. „So gehts, man weint und ist wirklich traurig und winkt noch mit dem Taschentuch, wenn der Zug schon weit weg ist. Und dann wischt man sich die Tränen ab und schneuzt sich die Nase.“
In der Garderobe nahm Nina einen schwarzen Spitzenschal um, der war noch von der Großmutter und aus Venedig.
Wir gingen langsam durch die Straßen bis zum alten Sendlinger Tor: „Ich wohne hier gleich um die Ecke,“ sagte Nina. Sie stand im Schatten, mir aber fiel der Schein einer Laterne ins Gesicht. Sie lachte und sagte: „Du hast noch ein richtiges Kindermäulchen.“ Das reizte denn doch meinen Ehrgeiz, ich nahm das Mädchen fest in die Arme und küßte ihren Mund, so gut es irgend ging.
„Kann ich’s noch immer nicht so wie der gute Thomas?“
„Immerhin, du bist recht gelehrig,“ bekam ich zu hören, „und nun adieu und erwarte mich morgen um sechs vor der Handelsschule am Altheimereck.“
Sie lief rasch davon und verschwand in der nächsten Seitengasse. Ich ging die Sendlingerstraße hinauf an dem Sterneck vorbei, wo die Laura Wunderl wohnte —
Am nächsten Abend kam Nina wirklich um sechs Uhr aus der Handelsschule und wir fuhren zu mir. Wir stiegen langsam die Treppen hinauf. „Noch eine Stiege, Fritz?“ „Ja, es sind im ganzen vier, dafür hat man aber auch von meinem Fenster viel Aussicht.“
Ich schloß meine Tür auf, gab dem Hund meiner Wirtin, der mich immer noch ankläffte, einen Tritt und führte Nina in mein Zimmer.
Sie sah nachdenklich die drei Plüschsessel mit den Häkelschonern auf der Lehne an, nahm die Nadeln aus ihrem Hut und hing ihn dem altdeutschen Hirschweibchen in der Ecke auf den Kopf. Dann legte sie sich mit einem Seufzer auf das Sofa, das erschrocken krachte und sah abwechselnd den König Ludwig und den Trompeter von Säkkingen an.
Es klopfte an die Tür und eine Hand mit Tellern und Messern erschien. Mehr wollte meine Wirtin aus Schamhaftigkeit nicht sehen lassen. Aber da ihr Jüngstes mitgelaufen war und an die offene Tür drängte, mußte sie, um es zurückzuhalten, unsern Blicken auch noch die andere Hand bis zum Ellenbogen preisgeben . . . .
Es war der Nina lange nicht warm genug im Zimmer. Sie schob alle Kohlen, die im Kasten waren, in den Ofen und setzte sich im Hemd ans Feuer, ihre Füße zu wärmen.
Aber so wurde es ihr doch zu heiß. Sie warf das Hemd ab, sprang auf das Sofa und hockte braun und schmal wie ein Bube an der Lehne.
Sie war zum Plaudern aufgelegt und erzählte von Katzen und Kindern und Mädchen und Männern. Ja, sie sollte mal verheiratet werden früher, sagte sie, aber es war nicht geglückt.
„Als ich siebzehn Jahre alt war, kam einer aus Mantua, wo meine Mutter her ist, der wollte mich zur Frau. Er hieß Herr Borromeo. Er hatte einen langen blauen Rock mit zwei goldnen Knöpfen hinten auf den Schößen. ‚Die müssen wir ihm abschneiden,‘ sagte mein kleiner Bruder, der ein schlimmer Bub war, aber der Vater hörte es und gab ihm eine Ohrfeige.
Ich hätte auch am Ende den Herrn Borromeo genommen und säße jetzt als Ehefrau in Mantua. Aber als er zum ersten Mal seinen Arm zärtlich um mich legte, biß ihn mein böser Bruder in die Hand; und Herr Borromeo ging verstimmt weg. Der Vater hatte viel Mühe, ihn wieder zu versöhnen.
Inzwischen blies mein Bruder jede Nacht vor meiner Tür so lange auf seiner Okarina, bis ich ihm aufmachte. Er war vierzehn Jahr damals und alle Mädchen sahen ihm nach. Er durfte sich an mein Bett setzen und mein weißes Kätzchen mit dem schwarzen Fleck an der Kehle streicheln. Einmal kam ihm der Vater auf die Spur. Da gabs Schläge. Aber das half nichts und als nun Herr Borromeo auf meines Vaters Zureden wieder einmal zu Besuch kam, stellte sich mein Bruder breitbeinig vor mich hin und sagte „laß uns in Ruh, Herr Blaurock, wir heiraten dich doch nicht.“ Das war zu viel, Herr Borromeo drehte sich schweigend um und langte seinen Hut vom Nagel. Da war der Spitzbub geschwind hinter ihm und schnitt ihm wirklich den einen goldenen Knopf vom Rockschoß.
Den brachte er zu einem Händler, bekam einen Taler dafür und für den Taler kaufte er mir eine große Vase mit Blumen, der gute Junge.
Der Händler — er war Witwer und hieß Jacob — sagte zu ihm: ‚Bring doch einmal dein Schwesterchen mit zu mir, sie soll sich meine schönen Ringe und Tücher und Siebensachen besehen.‘ Erst mocht ich nicht recht. Denn der Jacob hatte ein Faunsgesicht und einen spitzen roten Bart, aber schließlich kam ich einen Abend mit in den Laden. Der Jacob zeigte mir Rubine und Achate und wie all die Steine heißen, und so oft er einen beim Namen nannte, sah er mir in die Augen, daß mir ganz bang wurde. Zuletzt versprach er mir leise einen gotischen Goldreif, wenn ich übermorgen allein wiederkäme.
Ich habe nicht gewollt. — In der andern Nacht schlich mein Brüderlein wieder zu mir und war so gut anzusehen, daß ich ihn am liebsten in mein Bett genommen hätte. Aber er mußte auf dem Stuhl bleiben und die Katze streicheln. Ich schlief ein und träumte, ich wäre zwischen tausend Edelsteine eingesperrt. Die glitzerten aus allen Ecken und sahen nach mir wie böse alte Augen.
Und dann bin ich, ob ich auch gar nicht wollte, am Abend zum Jacob gelaufen. Wie wir hinterm Laden in der dunklen Stube waren, hatt’ er erst nur allerlei Kurzweil mit mir, lag zu meinen Füßen und legte den Kopf in meinen Schoß, recht demütig, daß ich ganz vergnügt wurde. Dann aber trieb er ein Spiel, das war mir noch sehr seltsam damals. Und ob ich meine Ohren schon immer offen hatte, wenn die Mädchen von den Männern erzählten, so wußt ich nun doch nicht, wie mir geschah. Ich lachte nicht mehr und mußte immer in die Luft fassen, als wär da oben meines Bruders schwarzes Haar zu streicheln. Und mit einemmal ward mir ganz schwach und schlecht, und der Jacob lachte.
Und wie dann in der Nacht mein Bruder bei mir saß, ach, der wußte nicht, warum ich so viel weinte!
Aber ich lief doch wieder zum Jacob und verlernte das Weinen und lernte allerlei. — Und der Jacob hatte einen Geschäftsfreund. Das ist der gute Thomas, der hat mich dann später nach München gebracht.“
Ninas Augen waren weit offen, während sie erzählte, und wurden immer größer und runder dann in der Nacht. Meine Kerze brannte herunter bis an die Manschette. Und als ich gegen Morgen ein wenig eingeschlafen war, kratzte mich Nina mit dem gotischen Ring auf der Brust und tat mir weh mit ihren langen Nägeln.
Für die Nägel mußte ich ihr meine schöne Nagelfeile aus Elfenbein schenken. Nina setzte sich auf die Bettkante, machte einen runden Katzenbuckel und feilte eine Stunde lang an ihren Fingern herum.
In der nächsten Woche wollte der gute Thomas nach München kommen. Nina freute sich gar nicht auf ihn und bestand darauf, daß wir beide bis zu seiner Ankunft täglich zusammen waren. Ich tat alles, was sie wollte, ging mit ihr spazieren und ins Theater; und wenn sie nicht da war, lag ich auf dem Sofa und rauchte Zigaretten. Dabei erwartete ich sie immer ohne Ungeduld, und ich ging zu ihr, wie in die Schule: zum Lernen.
Aber ihr Zimmer hatte ich sehr gern. Es war fast ganz ausgefüllt von dem Bett. Man sollte gar nicht glauben, daß es in München ein so großes Bett gab. Man konnte darin wohnen wie in einem Haus.
Und dann war es recht erfreulich, sie abends abzuholen, sie war immer noch mitten in der Toilette, wenn ich kam, und saß vor einem Handspiegelchen, das einen großen Sprung hatte. Während ihre Rechte die Brennschere über der Spiritusflamme drehte, hielt sie in der Linken ein Brot mit „Leoniwurst“.
Einmal, als wir zur Redoute wollten, fielen Tränen auf das Brot. Ich fürchtete schon, sie würde mir wegen meiner Lieblosigkeit Vorwürfe machen, aber sie sagte nur, „Ach Fritz, das ist ein Elend, ich seh heut so alt aus und mein Puder ist gar, und Parfüm hab ich auch keins mehr.“ Da lief ich rasch zur nächsten Drogerie und holte Puder und Eau de Cologne. Wie ich wiederkam, kniete sie am Ofen und heizte; sie konnte das wundervoll. Wenn sie tief in die Flammen faßte und der rote Widerschein auf ihrer Wange zuckte, hatte ich oft wirklich Lust, sie zu küssen. Aber dann mußte immer erst der Ofen geheizt werden.
Mein Freund Wedel, der Dichter, traf sie einmal nachmittags bei mir. Er war ganz entzückt und machte ihr umständlich den Hof. Er entdeckte, daß sie „Rasse“ hatte und „Temperament“ und was der Tugenden mehr sind. Er konnte viel mehr mit ihr reden als ich.
Wir waren einen ganzen Abend zu dritt zusammen im Variété und in der Teestube und spät nachts im Café Wittelsbach. Der Saal war schon leer, obwohl es eine Karnevalsnacht war. Nur ein paar zerknitterte Dominos und verstaubte Fräcke hockten noch in den Winkeln. Die Zigeunerkapelle spielte Csárdas.
Wedel und Nina sprachen von Italien; und er wußte schöne Dinge zu erzählen von verderbten Städten und ungewöhnlichen Lasterhaftigkeiten.
Den Tag darauf — es war der letzte vor dem Eintreffen des guten Thomas — fand ich Nina krank, sie zeigte mit ihrer magern Hand, die ein wenig zitterte, in den Winkel: „Da sind schon Lackstiefeletten vom Thomas, er will mich bald heiraten. Einen Kanarienvogel hat er mir auch versprochen. Ich wollte lieber eine Katze, aber Katzen mag er leider nicht.“
Ich sprach von Wedel und fragte, ob er ihr gefiele. Ja, sie mochte ihn schon ganz gern: „Aber eins verdrießt mich bei ihm.“
Was das wäre.
„Daß du gar kein bißchen eifersüchtig bist, wenn er mich anschaut.“
Sie setzte sich im Bett auf, holte die Nagelfeile unter der Decke hervor und feilte langsam an ihren bläulichen Nägeln. Ich saß auf dem Bettrand neben ihr, und wir schwiegen beide eine Weile still.
Mit einemmal sagte sie leise: „Es ist lieb von dir, Fritzchen, daß du immer zu mir gekommen bist und auch heut noch, wo du mich doch eigentlich gar nicht lieb hast.“
Ich stand auf und sah ihr verwundert in die Augen, dann streichelte ich verlegen ihr Kraushaar rund um den Kopf. Und Nina sagte: „Du hast nun am Ende alles gelernt, was es von mir zu lernen gab, und kannst gehen.“
Ich nahm meinen Hut, küßte ihre Hand und ging. Den nächsten Tag schickte ich ihr Blumen, weiße Narzissen, wie zu einem Begräbnis.
Nun dachte ich schon, das zwischen mir und der Nina wäre damit zu Ende; und so wäre es wohl auch am besten gewesen. Ich ging wieder allein spazieren und kümmerte mich nicht um die Mädchen.
Aber da kam eines Morgens ein Telegramm: „Erwarte mich um fünf in der Teestube, Nina.“
Nachmittags traf ich Wedel im Café, er wußte noch nicht, daß Nina mir den Abschied gegeben hatte. Ich hatte ihm nur gesagt, daß jetzt der gute Thomas hier war.
„Nichts Neues von Nina?“ fragte er.
„Sie hat mich in die Teestube bestellt,“ sagte ich.
Und als er schwieg, tat er mir leid und ich konnte nicht anders, ich mußte ihn bitten, mitzukommen.
„Du kannst die Nina viel besser unterhalten als ich,“ sagte ich. „Du tust mir einen Gefallen, wenn du mitkommst.“
Er sah mich etwas mißtrauisch an und meinte: „Du bist ein seltsames Geschöpf.“
Dann gingen wir in die Teestube, ließen in der Ecke Licht machen und warteten. Als Nina eintrat, merkte Wedel ihr an, daß seine Gegenwart sie befremdete und sagte: „Fürchten Sie nichts, schöne Nina. Ich werde nicht lange stören. Ich will mir bloß einen Augenblick meine kalten Finger an euerm Feuerchen wärmen. Dann laß ich euch Glücklichere allein.“
Aber es blieb nicht bei dem Augenblick. Der Dichter hatte wieder so vielerlei zu erzählen, und Nina legte die Ellenbogen auf den Tisch und das Kinn in die Hand und hörte mit runden Augen zu. Von Zeit zu Zeit sah sie nach mir zurück und streichelte an meinem Rock entlang. Dann sangen die beiden italienische Lieder, und wenn eins in der Strophe stecken blieb, half das andere weiter. Wedel hatte viel Liederhefte zu Haus, aus Italien mitgebracht. Die wollte sie gern gezeigt und vorgesungen bekommen. Er sagte: „Stehe jederzeit zur Verfügung. In meinem schon so ziemlich stark möblierten Zimmer steht noch zum Überfluß ein sehr geliehenes Piano, auf dem man zur Not musizieren kann.“
„Ach, gehen wir gleich hin,“ rief ich, „und trinken dort weiter Tee. Ich möchte heut den ganzen Tag nichts tun als Tee trinken. Du mußt wissen, Nina, daß Wedel sehr schöne chinesische Tassen hat und eine Teekanne aus rotem Ton mit einem gelben Drachen drauf.“
Wir zogen durch Regen und Laternendämmerung zu Wedel. Als wir unterwegs vor einem Schaufenster stehen blieben, faßte Nina meinen Arm fester und sagte: „Fritzchen, ich bin so froh, daß der gute Thomas wieder fort ist und daß ich bei dir bin.“
In seinem Zimmer steckte Wedel den Spirituskocher an und setzte sich dann ans Klavier. Erst spielte und sang er allerlei Neapolitanisches. Dann geriet er in einen Walzer; und Nina faßte meine Hände, zog mich vom Stuhl auf und tanzte mit mir im Zimmer herum. Die Hände legte sie mir beide auf die Schultern.
Das Teewasser kochte. Wedel sprang auf, schenkte Tee ein und holte Portwein und Curassao aus dem Schrank.
Wir hatten aufgehört zu tanzen, aber Nina lag noch immer in meinem Arm und ihre Hände blieben auf meinen Schultern.
„Nun wollen wir uns verkleiden,“ schlug der Dichter vor, und führte uns in sein Schlafzimmer. Nina stöberte im Schrank.
„Darf ich mir diese Tücher umbinden, ach und diese hier . . . . “
„Alles, was Sie wollen,“ sagte Wedel, kniete neben ihr nieder und streichelte den Schleier, den ihre Finger hielten.
„Ja, aber Sie müssen hinaus, so lange ich mich umziehe.“
Als wir beiden Männer wieder am Teetisch waren, flüsterte er: „Heut ist deine Nina aber schöner als je zuvor, du beneidenswerter kleiner Fritz.“ Er trank hastig Tee und Wein und Likör durcheinander.
Nina machte die Tür auf und stand vor uns in einem gelben Schal mit schwarzen Arabesken. Wenn sie sich bewegte, schmiegten sich die seltsamen Zahlfiguren zärtlich an ihr auf und nieder. Ihre Arme waren nackt.
„Jetzt ist die Reihe an mir,“ rief Wedel und glitt an uns vorbei ins Schlafzimmer.
Nina aber wollte wieder mit mir tanzen, weitertanzen ohne Musik. Langsam walzten wir im Raum herum. Ich berührte sie kaum, und ihre Hände lagen auf meinen Schultern, leicht, wie Blätter, die von Bäumen auf uns fallen. Sie machte mich sehr glücklich. Zuletzt wurde sie ein wenig schwerer in meinem Arm, und ich trug sie zum Diwan.
Wie ich sie hinlegte, kam Wedel herein, in einem indischen Schlafrock von großer Pracht. Sein braunes Haar klebte ihm in wirren Strähnen an der Stirn. Ich trat beiseite, als er sich der Nina näherte; sie lächelte müde.
Plötzlich hatte er sie empor gehoben, sie hing über seine Schulter, ihr Haar lockerte sich und eine schwarze Flechte fiel an seinem Arm herab. Seine Augen brannten wie Wolfsaugen im dunklen Walde und er trug seine Beute ins Nebenzimmer —
Ich blätterte in dem zärtlich weichen Papier eines japanischen Bilderbuches und blickte erst auf, als die beiden wieder hereintraten. Ich merkte ihnen einige Verlegenheit an und redete brav von japanischer Kunst.
Nina schlich ins Schlafzimmer zurück, kam in ihrem grauen Alltagskleid wieder und kroch auf den Diwan. Nach einer Weile sagte sie: „Ich bin müd, Fritz, bring mich heim.“
Wir standen auf. Wedel war noch immer in seinem bunten Rock und sah aus wie ein Theaterkönig hinter den Kulissen.
Auf der Straße ging Nina erst eine Zeitlang schweigend neben mir her, dann fing sie an: „Du bist schlecht mit mir, Fritz, ich schreib an dich allein: Komm, und freue mich auf dich. Und dann hast du den andern dabei und bringst mich nicht zu dir, sondern zu ihm. Und ich tanz mit dir und hab dich lieb, und dann kommt er und du läßt mich einfach wegnehmen.“
„Ja, was sollt ich denn tun?“
„Das durftest du nicht zulassen.“
„Ja, aber ich kann dir doch nicht befehlen: Laß ihn los. Wenn du nicht mochtest, warum . . .?“
„Aber mein Gott, wie war dir denn zumute, als er mich mit einem Mal forttrug?“
„Es sah gut aus, Nina. Ihr wart recht schön anzusehen.“
„Ach, Fritz, du kannst eben nicht lieben. Du hast nie ein Mädchen lieb gehabt und wirst nie ein Mädchen lieb haben.“
Darauf gab es nichts zu sagen. Wir kamen schweigend vor ihre Tür. Sie lud mich nicht ein, mit heraufzukommen, und sagte leise: „Adieu.“
Ich bog in die Sendlingerstraße ein. Es war Nacht. Die Laternenlichter schwammen trüb in der Luft und auf dem Pflaster.
Da sah ich was Rotes spiegeln und schimmern. Das waren Kirschen an einem Hut. Und wie es näher kam, war es das kleine Mädchen vom Dezember, welches Laura und Wunderl hieß.
„Guten Abend, Laura Wunderl.“
„Guten Abend, Herr Fritz.“
„Wo kommst du denn her?“
„Ei, ich bin Gassi-Gassi gewesen.“
„Sind schöne Leute gekommen?“
„Nein, gar niemand, du bist der erste; und wärs nicht schon so spät, so tät ich dich bitten: Komm mit zu mir, aber ich bin arg müde und gar nicht lustig.“
„Warum denn gar nicht lustig?“
„Ich weiß nicht. Ich mein, da ist der Bub, der Wastl, dran schuld. Wenn er nicht kommt, dann muß ich weinen, und wenn er kommt, noch viel mehr.“
„Wer ist denn das, der Wastl?“
„Ach, das erzähl ich dir ein andermal. Jetzt will ich schlafen. Gute Nacht, Herr Fritz.“
Das war zu bitter, daß sie nun gleich fort sein würde, und ich sagte: „Kannst du mich nicht einmal besuchen, kannst du nicht morgen zu mir kommen?“
„Ich zu dir, Herr Fritz? Deine Wirtin wird mich nicht hereinlassen.“
„Doch, doch, Laura. Komm, ich bitt dich, komm Laura.“
Und da hat sie mirs versprochen.
Die Nacht hab ich kein Auge zugetan und am Tage die Stunden gezählt. Nachmittags ging ich ein wenig zu Wedel, um die Zeit zu verbringen.
Ob ich ihm bös wäre wegen gestern, fragte er.
„Ich liebe doch die Nina gar nicht.“
„Und ich nur zu sehr, aber das gestern war nicht schön von mir, und ich schäme mich nun vor dir, Fritz. Was hat denn die Nina dazu gesagt?“
„Nina hat mich gescholten und gesagt, ich könnte nicht lieben.“
„So, und was sagst du selbst?“
„Ja, mir geht es seltsam, ich habe einen schlimmen Geschmack in der Liebe.“
„Nämlich?“
„Ja, denk dir, im Dezember ist mir einmal eine begegnet, die es für Geld tut. Und ich hatte sie gleich sehr lieb, mochte es aber selbst nicht wahr haben. Die hab ich gestern wiedergesehen und heut abend will sie mich besuchen. Es ist mir gar nicht recht, daß ich sie so lieb habe. Es wäre gut, wenn du sie mal sähst. Vielleicht, daß du mich dann von meinem dummen Wahn abbringen kannst.“
„Du bist kurios, mein Freund, unsereins ist ganz froh, wenn er einmal in einen rechten Wahn gerät.“
Aber er war neugierig und versprach zu kommen.
Zu Haus machte ich Licht und nahm das Corpus Juris vom Bücherbord, schlug es auf, legte die Arme auf die breiten Blätter und sah in die Lampe.
So saß ich wohl eine Stunde, dann schlug der Regulator sechs Uhr und Laura Wunderl trat ein.
Ich nahm ihr den tropfenden Schirm ab, um ihn in die Ecke zu stellen.
„Gib acht, er ist nicht mehr solid.“
Es war ein Bindfaden um den zerbrochenen Stiel gewickelt; man mußte vorsichtig mit ihm umgehn.
Dann wollte ich das Corpus Juris wegräumen. Aber sie bat mich, es aufzulassen, kniete auf einen Stuhl und las mit verwunderten Augen und begleitendem Zeigefinger darin.
„Es sind schöne, dicke Buchstaben,“ meinte sie, „aber es kommen keine Bilder.“
Da holte ich einen illustrierten Roman vom Bord, zeigte ihr die Bilder und erzählte die Geschichte dazu.
Aber davon wurde sie müde. Sie legte sich auf das Sofa, machte ihr Haar auf und flocht es in zwei lange Zöpfe, in denen sie wie ein kleines Schulkind aussah. Ich sollte nur weiter erzählen und nicht bös sein, wenn sie davon einschliefe.
„Geschichten sind so schön zum Einschlafen.“
Und als die Geschichte fertig war, setzte ich mich zu ihr, streichelte ihre blonden Zöpfe und küßte ihre heiße Stirn.
Es klopfte. Laura hob den Kopf; und Wedel trat ein. Er hatte Abendbrot mitgebracht.
Das gab einen lustigen Schmaus, das Mädchen wurde von uns beiden abwechselnd gefüttert. Und wie wir fertig waren, machten wir aus dem Einpackpapier kleine Bällchen und warfen uns damit.
Wedel wollte immer, daß Laura von ihrem Leben erzählte. Aber sie war müde und mochte nicht.
„Schon so viel herumgelaufen?“ fragte er.
„Nein, heut hab ich noch gar nichts verdient.“
Da schenkten wir ihr jeder einen Taler. Sie legte die beiden Silberlinge nebeneinander auf den Tisch und sagte: „Wie lustig sie miteinander sind. Nun wollen wir sie rollen.“
Da rollten wir sie erst auf dem Tisch, und als sie immer wieder herunterfielen, knieten wir alle drei am Boden und rollten sie einander zu. Dann bekam die arme Kleine Kopfweh. Sie hätte jetzt immer soviel Kopfweh, klagte sie, man müßte mit ihr sein, wie mit einem kranken Kind. Da betteten wir das Kind auf unsern Knieen. Ihr Kopf lag auf dem Kissen an der Sofalehne. Wir summten ihr Wiegenlieder und sie schlief ein.
Es klopfte wieder und herein kam der Maler, den wir Rübezahl nannten. Ich kannte ihn erst kurze Zeit. Heut besuchte er mich zum ersten Mal, er hatte einen grünen Radlerrock an und behielt immer die Mütze auf dem Kopf und einen abgebrannten Zigarrenstummel im Mund. Wir erzählten ihm im Flüsterton von dem Wesen auf unsern Knieen. Und er sagte, wir solltens nur ja nicht wecken, er wollte das zeichnen. Er holte ein Skizzenbuch aus der Rocktasche, rückte die Lampe näher an seinen Platz und zeichnete. Und davon und von Lauras vielem Schlaf wurden wir beide auch müde, lehnten uns zurück und schlummerten ein wenig.
Laura aber schien ganz fest eingeschlafen zu sein. Als wir sie aufhoben, um selbst aufzustehen, und sie wieder zurückbetteten, regte sie sich kaum. Sie rückte nur den rechten Arm unterm Kissen näher an den Kopf und legte die linke Hand in den Schoß.
Auch das wollte der Rübezahl noch rasch zeichnen. Und ich mußte ihm die Laura als Modell versprechen. Dann gingen die Freunde fort.
Kaum waren sie zur Tür hinaus, so richtete sich die Laura ein wenig auf und sagte: „Ich will nun auch gehen.“
„Ich dachte, du schläfst ganz tief?“
„Nein, ich habe nicht geschlafen. Ich muß bloß meine Augen zumachen vor euch. Ihr schaut mich zuviel an.“
„Bleib nun doch bei mir, ich will dich auch gar nicht ansehn.“
„Du bist gerad der Schlimmste, Fritz, laß mich heut. Ich bin so fiebrig und matt. Will schlafen gehn.“
„Schlaf doch bei mir,“ sagte ich, „ich lasse dir mein Bett.“
„Du bist recht lieb zu mir, Fritz. Aber das tät dir nicht gut und du dauerst mich dann so sehr. Laß mich gehn.“
Und dann gab ich ihr noch ein paar Bücher zum Lesen mit und küßte sie traurig, und sie versprach mir bald zu schreiben und ging.
Die folgenden Tage wartete ich immer auf ein Wort von der Laura. Sowie etwas Weißes in meinem Briefkasten stak, dachte ich: endlich. Aber dann war es nicht von ihr.
Einmal war ich schon fest entschlossen, einfach zu ihr hinzugehen. Doch da regte sich mein Stolz: sie sollte selbst an mich denken, zu mir wollen.
Manchmal stand ich auch in der Abenddämmerung am Fenster und dachte: wenn du recht lange und geduldig hinausschaust, kommt sie am Ende. Aber sie kam nicht.
Die Freunde Wedel und Rübezahl fragten mich immerzu nach ihr und ich konnte ihnen keinen Bescheid geben, bis ich endlich nach vierzehn langen Tagen (am Karnevalsonntag wars), diesen Brief erhielt.
Geehrter Fritz!
Im Gefängnis da gibts keine rechte Seife, kein Zahnbürstl und nichts was man braucht. Aber die andern Mädchen kriegen von auswärts Geld, gebens dem Beschließer und der holt ihnen alles. Wenn Du mir was schicken könntest, lieber Fritz, ich wäre Dirs immer dankbar.
Lieber Fritz, ich bin so müd immer, entschuldig die schlechte Schrift mit dem Bleistift. Ich lieg hier neben einer Großen, die mich lieb hat, und sie hat ein Buch im Schoß. Darauf schreib ich, bis der Beschließer kommt und uns voneinand jagt. Denn wir sollen nicht zusammen sein und sind doch alle in ein großes Zimmer gesperrt. Da waren zwei schöne große Mädchen. Die haben auf einer Streu geschlafen. Und weil sie sich lieben, so flechten sie ihr Haar zusammen. Den hat ers Haar verschnitten, mitten in der Nacht. Wo wir doch sonst keine Liebe haben und können dochs Liebhaben nicht so einfach lassen, nicht wahr? Es gewöhnt sich doch. Aber dann gibts Schläg.
Wie ich hierher gekommen bin, das soll Dir Mutter Milly sagen. Ich bin nun zu müd. Ist auch zu fad. Ach, Fritzl, all meine Lustigkeit ist hin. Finster ists hier und riecht sauer nach dem Rock von dem, der wo hier stöbert.
Diesen Brief nimmt eine mit, die heut frei kommt, sonst werden alle Briefe nachgesehen, weißt Du. Wenn ich Dich nochmal sehen sollte, will ich Dich sehr viel küssen für alle Lieb, die Du an mir getan hast. Es grüßt Dich
Deine auf wiedersehende
Laura.
Ich brachte rasch Geld auf die Post und lief an tutenden Kindern und bunten Masken vorbei durch den Konfettiregen zu Lauras Wirtin. Da erfuhr ich denn, daß die Laura von der Polizei überrascht worden sei. Sie hatte keinen Schein. Aber sie würde wohl bald wieder frei kommen, dann wollte die Alte sie gleich zu mir schicken.
Nun hieß es rasch die Tage vertreiben. Dazu war der Karneval gut. Ich lief gleich zu Rübezahl, der vielerlei Kostümfetzen hatte, er steckte mich in einen blauen Dachauer Rock und drückte mir einen großen schwarzen Hut auf den Kopf bis über die Ohren. Unter dem Hut blieb ich zwei Tage und zwei Nächte. Und davon wurde mir dumpf im Kopf. Das tat mir gut.
Rübezahl hatte einen langen Biedermeierfrack an mit engen Hosen und hohen Vatermördern. Dazu kam dann noch Wedel als weiß gekleideter und gepuderter Pierrot und andere Freunde. Und so liefen wir in der Stadt herum, drehten Laternen aus, küßten geschminkte Lippen, rieben uns die angeflogenen Konfetti aus den Augen und bewarfen die anderen mit unserm Vorrat.
Am Montag Abend war ich einmal mit dem Rübezahl allein. Wir saßen im automatischen Restaurant und tranken Kaffee. Er rauchte an seinem Zigarrenstummel und redete über die „Weiber“.
„Die ruhigsten, das sind die besten, mein Sohn. Fall nur nie auf Temperament herein. Ich werde dir mein schönstes Abenteuer erzählen. Da bin ich mal einer begegnet. Schlank, stumm. Schielte ein wenig. „Darf ich Sie begleiten?“ sagte ich. — „Wenn Sie wollen.“ — Na, sie war für München recht wohl gekleidet und so schlug ich ein besseres Lokal vor. — „Wenn Sie wollen,“ sagte sie. — „Darf ich Sekt bestellen?“ — „Wenn Sie wollen.“ Nun fragt ich nach Nam und Art. — Sie war mit einem Dresdner Maler verheiratet gewesen, der hätt sie so oft gefragt, ob sie ihn wirklich liebte, bis sie davongelaufen wär, hierher zur Mutter zurück. — „Na und die Mutter läßt Sie so allein herumgehen?“ — „Warum nicht?“ — „Trinken wir noch einen Tee bei mir?“ — „Warum nicht?“
Wie es nun zwei Uhr Nacht wurde beim Teetrinken, sagte ich: „Sie werden jetzt zu müde sein zum Heimgehen, darf ich Ihnen mein Bett anbieten?“ Ja, das durfte ich. Da lag sie nun in einem langen weißen Hemd und schielte. „Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten?“ fragte ich. — „Wenn Sie wollen.“
Na, ich versichere dich, ich war nie so verliebt. Sie war still und hatte nichts dagegen; nur einmal hat sie etwas stärker geschielt, das deutete ich zu meinen Gunsten.“
Während er erzählte, hatte sich eine rotbäckige, rundliche Blondine an den Nebentisch gesetzt, einen Haufen runder und eckiger Pakete rings um sich verbreitet und aß nun nachdenklich an einem Schinkenbrot. Rübezahl sah schon beim Erzählen bisweilen zu ihr hinüber. Nun fiel endlich eins von den Paketen herunter und rollte zu uns. Rübezahl hob es auf, überreichte es ihr mit einer umständlichen Verbeugung und sagte: „Sie haben aber viel Pakete, Fräulein, was haben Sie denn Schönes angeschafft?“
„Die Pakete sind nicht für mich, die sind für meine Hunde.“
„Hunde?“
„Ja, in der Garderobe darf ich sie nicht lassen, der Direktor erlaubts nicht.“
„Was tun Sie denn mit den Hunden?“
„Ich bin doch Dresseuse. Und während daß die Hundln sich abkühlen, gehe ich immer vom Variété hier herüber und eß was. Nachher hol ich die Hundln und bring sie heim.“
„Gewiß ein sehr anstrengender Beruf.“
„Es gewöhnt sich. S’ist nur schlimm, wenn einem die Tiere eingehen. In Berlin da hatt ich so schöne Foxe und die sind mir all eingegangen, weil der Käfig feucht war. Da hatt ich nichts zu essen zwei Tage lang. Dann hat sich der Herr Schnellmaler Mink meiner angenommen und hat mirs Schnellmalen beigebracht.“
„Das ist gewiß recht schwer. Ich selbst bin nur ein langsamer Maler und hab schon Müh genug.“
„Mit Landschaften wärs nicht so schwer. Die hab ich bald gekonnt. Aber die Köpf . . . . Herr Mink war ein Künstler. Er hat früher sogar mal ausgestellt. In der großen Pommerschen Landesausstellung. Das ging ihm noch nach. Eine schöne Samtjoppe hatte er. Die zog er morgens immer übers Hemd an und rauchte Zigaretten. Es war eine schöne Zeit. Aber dann mußte er fort, eh ichs Schnellmalen ganz erlernt hatte. Und da haben mich die Herrn Jongleure übernommen. Die brauchten eine Dame zum Zureichen und fürs Honneur. Und wo ich doch die gleiche Figur hatte, wie die vorige, die wieder Friseuse geworden ist, so konnt ich ihre Kleider mit übernehmen.
Da bin ich weit herumgekommen. Zuletzt waren wir in Brüssel, aber dann hatt ich wieder Lust, mich selbständig zu machen, und der Jemmy, der mich lieb gehabt hat, der hat mir ein Geld gegeben. Davon hab ich mir in Hamburg ein paar Pudel gekauft. Mit denen reis ich jetzt. Jetzt tu ich sie auch nicht mehr in den Käfig, sondern halt sie bei mir im Zimmer. Sie müssen mich mal besuchen kommen und meine Hundln anschauen.“
Ja, das wollten wir wohl und nächstens kämen wir ins Variété, sie auftreten zu sehen.
Jetzt aber, meinte der Rübezahl, jetzt sollten wir uns eine vergnügte Nacht machen auf seinem Atelier.
Sie mußte erst noch die Hunde heimbringen. Indessen kauften wir zwei Flaschen Automatensekt, erwarteten sie im Café und fuhren dann per Droschke zu ihm.
Sie saß auf Rübezahls Knieen und schnalzte mit der Zunge. Da ich gegenüber saß, fing ich nun auch an, ihre Aufmerksamkeit zu erregen.
„Was ist denn das für einer, dein kleiner Freund?“
„Das ist noch ein junger Hund,“ sagte Rübezahl.
„Um so besser zu dressieren,“ meinte die Hundedame.
Auf dem Atelier malte sie erst mit Rübezahl um die Wette schnell, und ihre Landschaft stand eher auf der Leinewand als seine.
Dann tat der Sekt seine Wirkung: es wurde Dressur gespielt. Rübezahl bellte so schön, daß sie sich vor Lachen nicht halten konnte.
Zuletzt schaukelte sie wild auf dem Schaukelstuhl auf und ab und las uns einen Liebesbrief von Jemmy vor: „Oh kleine Dogsmiß, arbeiten Du noch mit Dogs? Wir arbeiten immer noch Brüssel. In Pause und auf Bude ich lieben Dich viel. Oh, kleine Dogsmiß, wir haben gut können dressieren der Liebe. Oh man muß können arbeiten. Diesen Winter ich werde arbeiten Budapest, wo sind schöne Weiben. . . .“ Und so gings immer weiter. Wenn sie beim Lesen einhielt, gab ihr Rübezahl aus der Flasche zu trinken. Ihr Stuhl schaukelte immer langsamer, der Kopf sank auf die Brust und der Liebesbrief fiel auf die Erde.
Da legten wir sie in Rübezahls Bett, deckten sie zu und gingen wieder in den Karneval zurück.
In der Dienstagsnacht waren wir im Luitpold. Ich sah wohl sehr müde aus. Das nahmen alle für Maske und fanden mich sehr gelungen.
Einmal kam das Kätchen vorbei als fleischfarbene Fee: „Gelt, du bist ein Schlimmer, hast mich ganz vergessen. Dafür hab ich jetzt einen lieben Schatz.“
„Und ich keinen,“ sagte ich und ging weiter.
Und die Nina kam an Wedels Arm und wollte mich küssen. Warum ich nicht küssen wollte, fragte sie, als ich auswich; küssen wär doch was Schönes. — Ich fänds auch sehr schön, sagte ich, aber ich taugte nicht dazu. Da lachten sie alle.
Ich trank viel Sekt und Kaffee und Bier und wieder Kaffee und wieder Sekt, und als wir später noch im Stephanie waren, schlief ich immerzu an Wedels Schulter ein, wenn es einen Moment stiller wurde. Da saßen dicke Bürger und blasse Studenten und fleckig geküßte Mädchen, alle aßen Weißwürste.
Dann nahmen mich die Freunde zwischen sich in eine Droschke, und es ging rasend schnell und quälend langsam an drehenden Plätzen und auf steigenden und sinkenden Straßen hin bis in Rübezahls Atelier.
Dort wurde ich neben die Hundedame aufs Bett gelegt; sie wollte mir den Hut abnehmen, um mir ins Gesicht zu sehen. Aber ich wehrte mich, zog ihn tief in die Stirn und schlief in den grauen Aschermittwoch hinein.
Dann dauerte es noch ein paar lange Tage, bis ich endlich einen Brief von Lauras Wirtin bekam:
„Liebwerter junger Herr, ich muß Ihnen nun die Meldung machen, daß die Laura Wunderl gestern ins Spital links der Isar gekommen ist und hat mir in ihrem Schnupftuch sechs Mark dreiundsiebzig gegeben, die über waren von dem, was ihr der junge Herr ins Gefängnis geschickt haben. Sie ist immer im Fieber und lacht und kennt niemand. Nur mich kannte sie an meinem Kopftuch und grauem Scheitel, gab mir das Geld und sagte: ‚Da sind noch silberne Gickerchen. Tus wieder in ihren Topf, daß sie klappern. Ich brauchs ja nimmer.‘
Ich bin eine ehrliche alte Frau und ich mein, es wär nicht recht vor unserm Herrgott, wenn ichs Ihnen nicht wiedergeb. Nur wollt ich recht bescheiden gebeten haben, daß der junge Herr vielleicht die Güte hätten, noch einige kleine Schuld, die von der Laura aussteht, gefälligst zu bereinigen. — Wenn sich der junge Herr herbemühen wollten, ich bin immer in meiner Küche, möcht auch gern von den Umständen der Laura erzählen. Möcht hören, was ein gebildeter Herr dazu meint. Wann der junge Herr umsonst schellen, so bin ich drüben bei meiner Nachbarin, wo ich mir immer das Wasser aus der Leitung hole. Untertänigst
Emilie Sippl,
Briefträgerswitwe.“
Darauf ging ich erst ins Spital, um Laura selbst zu sehen. Aber ich wurde nicht vorgelassen. Es war kein Besuchstag für den Saal, wo sie lag.
Von da lief ich weiter zur Mutter Milly ins Sterneck. Sie machte mir auf, schlich voran in ihre Küche und setzte sich auf den Strohstuhl weinen. Ich nahm auf dem Tisch Platz und wartete bis sie ausgeweint hatte.
Nach einer Weile sah sie auf und sagte: „Nun kommt das Kind ins Arbeitshaus. Sie habens mir fortgenommen.“
„Wie ist denn das alles gekommen?“
„Ich mein, der Wastl ist schuld.“ Dann fing sie an, mit leiser, singender Stimme zu erzählen.
„Es ist eben ein besonderer Fall, das hat auch der Herr Doktor im Spital gesagt. Das arme Kind. Was hab ich Zeitlang nach ihr, wo ich ihre Mutter noch so gut gekannt hab. Die Mutter, die hat dazumal hier unten im Haus gewohnt, bei ihrem Vater, dem alten Tischlermeister Wunderl. Wir waren im gleichen Alter, die Theres Wunderl und ich. Wir sind zusammen zur heiligen Kommunion gegangen. Ach, sie war immer still und fleißig und hat viel Umständ gehabt mit dem ledigen Kind. Es ist ihr einziges gewesen. Und sie hat sonst keine Sünde gehabt, hat auch nicht heiraten mögen, auch nie die Mannsbilder angeschaut. Hat immer nur ihr Kind geherzt und es ihren allerliebsten Bankert geheißen. Ach, wenn sie gewußt hätt, wies dem armen Kind gehen sollt! Aber wer weiß denn, warum der Herrgott der Laura so ein heißes Herz gegeben hat. Nun wird sie Kesselkost essen müssen und war bei mir so ein gutes lindes Essen gewohnt.
Aber nun will ich Ihnen alles nach der Reihe erzählen, lieber Herr, und das fängt damit an, wie die Theres zu dem Kind gekommen ist. Das ist eine eigne Geschichte.
Das sind nun schon viele, viele Jahre, da sind wir zwei, die Theres Wunderl und ich, auf die Oktoberwiese gegangen. Da wars dazumal noch nicht so prächtig wie jetzt, auch nicht so viel Fremde. Und wenn mal ein Fremdes gekommen ist, so haben wir sehr nach ihm geschaut. Da kam denn auch einer, der uns zwei Mädchen so spazieren sah. Er hatte einen porzellanenen Knopf an seinem Stock und ein dickes Uhrgehänge und so lichtes Haar, wie es die Laura von ihm geerbt hat. Einen blonden Schnurrbart hatte er, der im Wind wehte. Es war ein stattlicher Mann, er hat manierlich zu uns gesprochen und ich hab geantwortet. Die Theres hat sich nur geduckt.
Und wie wir so gehen, sehen wir mit einmal die große erzene Bavaria über der Wiese. Da kehrt sich der Fremde zu der Theres und spricht: ‚Sagen Sie mir doch, kleines Fräulein, wer ist die große Dame?‘
Wie die Theres darauf nur kichert, stoß ich sie in die Seite: ‚Ei, so gib doch dem Herrn Bescheid.‘ Ja, sie sollte ihm die Erzene genau zeigen, er hätt gehört man könnt hineingehen, meinte der fremde Herr und ließ nicht ab, bis sie mit ihm hinging. Ich blieb bei der Ochsenbraterei stehen und sah den beiden nach, und wie sie dann weiter waren, tat er den Arm um die kleine Theres. Das machte mich traurig weil ich dazumal keinen Schatz hatte und ich ging allein nach Haus.
Am späten Abend aber kam die Theres zu mir und hatte ganz rot geweinte Augen. Nun wär alles aus, nun bekäm sie ein Kind: Wovon denn gleich ein Kind. Ja, das hätt sie wohl gespürt. Und dann erzählt sie: Wie sie mit dem fremden Herrn zu der Bavaria kam, saß der Wärter auf der Schwelle und aß sein Vesperbrot. Der wollte sie nimmer hineinlassen, weil es schon spät war. Der fremde Herr aber sagte ihm: ‚Ich bin nur noch bis heut nacht in München, und das muß ich doch gesehen haben,‘ und gab ihm ein Geldstück. Da holte der Alte eine Kerze, steckte sie ihnen an und ließ die beiden hineingehen. Und wie sie bis in den Schoß hinaufgestiegen waren, wo eine Bank zum Ausruhen steht, da ging mit einem Mal die Kerze aus.
Wie das die Theres erzählte, mußte ich hell herauslachen: ‚Ja die andern haben auch gelacht, sagt sie, aber was hilft mir euer Lachen. Ich bin wie tot dagelegen und weiß nicht, wie ich wieder heruntergekommen bin.‘ Und unten hat der fremde Herr gesagt: ‚So mein Kind, ich muß heim ins Hotel‘ und hat mir den Taler hier gegeben und war weg.‘ Und dann bat sie mich recht sehr, ihr doch den Taler abzunehmen. Sie wüßt nicht wohin damit und hätt Angst er brächt ihr Unglück. Sie hatte ihn eingewickelt in Zeitungspapier und so nahm ich ihn und tat ihn in ein Glücksschwein, das auf meinem Fensterbrett stand.
Und als die Zeit um war, ist die Theres schwanger gewesen. Und die zuvor gelacht hatten, machten nun ein ernsthaftes Gesicht; und wie sie das Kind zur Welt brachte, war der alte Tischlermeister bös und wollte das ‚Bankertgequäk‘ nicht hören.
Ich hatte aber dazumal meinen seligen Mann, den Sippl geheiratet und wir waren hier oben ins Haus gezogen. Und mein Mann, der ein einfacher Mann war, meinte: ‚Was brauchen wir die gute Stube? Haben wir nicht an der Küche und am Schlafzimmer genug? Laß die arme Theres drin wohnen mit ihrem Kind.‘ Da nahmen wir die Theres zu uns herauf und sie saß den ganzen Tag im Zimmer, nähte und sang dem Kind Lieder. Und die Laura war lieb und still und so schön anzusehen, daß alle ihr gut sein mußten.
Aber die Theres Wunderl war seit dem Kindbett recht schwach und hinfällig und hatte Gliederweh. Und wenn sie dann in ihrem Stuhl stöhnte, dann kam die kleine Laura gekrochen, gesprungen und brachte alles was sie Schönes gefunden hatte. Und wo das Kind hinfaßte am Boden, da war ein bunter Faden oder ein seidener Fetzen. Und unten auf dem Hof fand es Glasscherben, die ließ es in der Sonne glitzern; behielt aber nichts für sich, wie ichs sonst wohl gesehen hab, daß Kinder alles in ihre Ecke sammeln, sondern gabs den kleinen Buben, die vorbeikamen.
Mit der Theres hats dann nicht lang gedauert: Als ihre Laura in die Schule kam, ward sie schwer krank. Und einmal im Frühling, wie das Kind morgens mit seiner Schreibtafel fortging, hat sie es noch geküßt, und wie es heimkam, war sie tot.
Die Laura wurde ein recht braves Mädchen; das muß ich sagen. Gespielt hat sie am liebsten mit den Buben, und alle bunten Röcke haben ihr wohlgefallen. Wenn mein seliger Mann, der Briefträger Sippl, seine Sonntagsmontur anhatte, dann ist sie zu ihm gesprungen und hat schön mit ihm getan. Und allen Soldaten, die vorbeikamen, hat sie Kußhände zugeworfen und so ist denn auch ein bunter Rock ihr erstes Unglück gewesen.
Es ist einmal — da war sie schon ein wenig erwachsen — da ist ein herrschaftlicher Diener gekommen mit Wäsche zum Ausbessern. Wie er in die Küche trat, stand die Laura am Herd und schaute ihn an, hat aber kein Wort gesprochen. Des Abends setzte ich mich wie immer an ihr Bett, schwätzte mit ihr und las ihr aus einem heiligen Buch vor. Und darüber schlief sie ein. Ich las noch ein wenig weiter. Mit einem Mal hör ich das Kind stöhnen und aus dem Schlaf sprechen. Es hatte ganz fiebrige Wangen, aber was sie sagt, konnt ich nicht verstehen. — Als aber nach ein paar Tagen der herrschaftliche Diener wiederkam die Wäsch abholen, war ich grad fort einkaufen und hatte der Laura angeschafft, auf die Schelle achtzugeben. So macht sie ihm auf. Und als ich dann heimkomm, springt sie mir entgegen, mit roten Wangen und küßt mich und läßt mich gar nicht zum Fragen und zum Schelten kommen. ‚Das ist ein wunderlich Ding, ein Mann,‘ sagt sie. Und dann erzählt sie, sie hätt ihn eh er sich versah in die Stube hereingezogen, weil es in der Küche schon zu dunkel war, die Wäsch zu besehen. Und wie er mit ihr am Fenster stand, faßt sie seine goldnen herrschaftlichen Knöpfe an. Und das gefiel ihm wohl. Er zeigte ihr auch seine Westenknöpfe. Und sie zeigte ihm dafür ihr buntes Strumpfband — und so gings weiter — bis das Unglück geschehen war. Aber sie hat nie verstehen wollen, daß das ein Unglück war und ich hab Müh genug gehabt, daß sies nur ja nicht meinem Mann erzählte.
Und dann ist das andere Unglück gekommen, daß ich meinen armen Mann, den Sippl, verloren hab, indem er sich dienstlich verkältet hat und hat sichs ihm derart auf die Brust geschlagen, daß es bald um ihn geschehen war. Ich wollt erst selbst nachts die Leichenwacht halten, aber die Laura drängte mich immer wieder von der Kerze fort, hockte sich auf den Schemel am Bett und schaut dem Toten in sein Angesicht. Den Mund hatte sie ganz verwundert offen und sah nicht aus, wie ein Christenmensch, der einen Christenmensch hat sterben sehen, sondern schier wie ein Kind, das vor einem Guckkasten, vor einem Kasperltheater sitzt.
Am andern Morgen, als es zu den Nachbarn gekommen war, daß mein Mann mit Tode abgegangen, wer steckt als erster seinen dicken Kopf in die Tür? Die hatt ich angelehnt derweil ich Wasser holen ging. — Der Wastl natürlich, des Herrn Gendarmen im dritten Stock sein neugieriger Sohn. Sie sind ihm wohl schon auf der Gasse oder auf der Stiege begegnet und kennen ihn an seinem roten Haar und blöden Aug und wie ihm das Maul ein wenig hängt und wie er mit den Armen herumrudert in der Luft, eh er das Stiegengeländer zu fassen kriegt. — Der schiebt also die Tür auf und wie er mich nachkommen sieht, macht er eine schiefe Reverenz und geht voran und in der Laura ihr Zimmer, wo wir den Toten aufgebahrt hatten.
Wie er da nun aber den Toten liegen sieht und das Mädchen, die Laura, dabei sitzen, kriegt ers mit der Angst und will zurück. Da winkt ihm die Laura herzukommen und er kriecht auf allen Vieren bis zu ihren Knieen. Und dann packt sie mit ihren Fingerchen den großen Gesellen am Schopf und lacht und stupft ein paar Mal seinen dicken Schädel ganz dicht an das Gesicht des Toten und sagt: ‚Schau ihn dir recht an, Wastl, daß du ihn nicht vergißt.‘
Und seitdem ist der Wastl jeden Tag heraufgekommen, und die Laura hat ihn gehalten wie einen Hund mit Schlagen und mit Streicheln. Er hat ihr alles zulieb tun müssen: die Schuh ausziehn, wenn sie müd war, und Gesichter schneiden und auf einem Bein stehn, bis er umfiel. Und da sie mir dazumal mit Nähen fleißig beigestanden ist, so hat sie immer eine Nadel in der Hand gehabt, mit der hat sie den Wastl gestochen und dann das Blut mit ihren Lippen aufgesogen.
Und ob sie ihn schon immer einen dummen Buben geheißen hat, so konnt sie doch keinen Tag ohne ihn sein, und wenn er mal nicht kam, so blieb sie im Bett liegen bis Mittag und sagt: ‚Ich mag nichts nähen, ich mag nichts essen. Wo bleibt der dumme Bub, der Wastl?‘
Und über eine Zeit, so habens die beiden schon schlimmer getrieben, aber ich hab ein Auge zugedrückt, weil ich die Laura so lieb hatte und die andern Mädel treibens ja auch nicht besser. Nur daß sie so gar keine Scham gehabt hat, wo sich doch sonst die Mädchen nicht genug tun können, mit Heimlichkeit und in den Schoß gucken und’s Licht ausblasen und was derlei Schamhaftigkeiten mehr sind. Die Laura aber hat mir nicht Ruh gelassen, bis ich noch hereinkam, wenn sie den langen Buben da auf ihrer Bettstatt liegen hatt. Und das erste Mal hab ich nicht gemocht. Das andre Mal bin ich in der Tür gestanden und hab gelacht. Und zuletzt mußt ich ganz herein und mich auf den Stuhl am Bett setzen, und die Laura stützt ihren Ellbogen auf mein Knie und mit der andern Hand streichelt sie ihrem Wastl das rote Haar und sagt: ‚Mutter Milly, erzähl uns was Schönes.‘
Und so wunderlich michs ankam, so hab ich den beiden Geschichten erzählt, wie zwei kleinen Kindern. Und dann hat die Laura schelmisch gelacht und gesagt: ‚Mutter Milly ich hab Durst, bring mir ein klares Wasser‘ und da bin ich hinausgegangen, hab aber erst ein Weilchen gewartet eh ich mit dem Wasser wiedergekommen bin.
Und so wärs denn auch leidlich weitergegangen, aber der Herr Gendarm ist seinem Sohn auf die Spur gekommen. Und weil der Bub faul war in seinem Handwerk (er war bei einem Spängler in der Lehre) und oft um der Laura willen den ganzen Tag ausblieb, so mochte der Alte ihm keine Entschuldigung mehr für den Meister schreiben und ließ ihn nicht mehr zu uns herauf.
Da ist die Laura erst zwei Tag lang mäuschenstill im Bett gelegen, am dritten ist sie in die Küche gekommen und hat meine Mietzkatze gestreichelt und geplagt, und am andern Abend hat sie ihren Hut aufgesetzt, den sie von meinem seligen Mann zur Kommunion gekriegt hat, ein schönes Stück mit Kirschen drauf, und ist auf die Gasse gegangen. Und spät ist sie wieder gekommen und war nicht allein. Da hats mich geschauert und ich bin ihr nicht an die Tür entgegen wie sonst, bin in meiner Küche sitzen geblieben und hab still geweint. Wie ich so sitz, hör ich mit einmal ihre helle Stimme: ‚Mutter Milly, ich hab Durst, bring mir ein klares Wasser.‘ Ich hab gezittert vor Schreck, aber was das Kind anschaffte, mußte man tun. Und so kam ich mit dem Wasser an die Tür und da ist es mir aus den Händen gefallen. Kommt die Laura heraus, ach was war sie hold anzuschauen in ihrem hellen Haar und blanken Hemd. ‚Mutter Milly, was verschrickst du dich?‘ sagt sie. Und nun wo sie vor mir stand, war auch mein Schreck vorbei.
Am andern Morgen aber wollt ich ihr ins Gewissen reden und sagt ihr so ein wenig, was sie tat. Da gab sie mir ein großes Goldstück und sagte: ‚Das hat mir einer geschenkt, den ich lieb hatte. Ich glaub, ich hab viele lieb, und wenn mir jeder was schenkt, so haben wir beide, du und ich, keine Not. Und wenn der Wastl nicht dabei ist, kann ich nicht nähen und was du unter deiner Brille zusammennähst, das reicht nicht aus.‘
Und ich sagt ihr darauf, daß sie so nie einen Mann zur Ehe bekäme und daß alle sie schelten und schief ansehen würden und nimmer mit ihr reden. Sagt die Laura wieder: ‚Ansprach brauch ich keine, außer wer mich lieb hat. Und Männer möcht ich viel und nicht einen zur Ehe, und ich bin besser gemacht zum Liebhaben als zum Nähen und wenn der Wastl nicht da ist, kann ich doch nicht nähen‘ . . . und so gings immer fort.
Und so ists gekommen, daß die Wittwe eines rechtschaffenen Mannes, wenn mans recht besieht, die Magd einer Hure geworden ist. Ich hab wohl noch an meinem Küchentisch genäht, aber wenns dann schellte, so mußt ich aufmachen und Bescheid geben, ob das Fräulein zu Haus wär. Und das Fräulein hat auf dem Bett gelegen und mit der Katz gespielt. Das ganze Zimmer war voll Blumen, davon konnt sie nie genug haben, ob ich ihr schon oft gesagt habe, daß in so einer Kammer Blumenduft gefährlich ist auf die Nacht.
Ich hab mich auch oft gewundert, daß sie keine Zeitlang nach der Arbeit gehabt hat. Sie hat sich nicht einmal ihre Wäsch genäht und wenn sie eine Nadel in der Hand hatt, näht sie damit bunte Blumen auf seidne Tücher. Aber ohne allen Nutzen. Sie hat nie einen seidnen Rock gehabt oder wie sonst die schlechten Mädchen seidne Jupon und seidene Wäsch. Ging immer in Leinen und Kattun.
Und bei all der Sünde ist sie von Tag zu Tag lieblicher geworden. Und so ists wohl auch gekommen, daß ein so feiner Herr, wie Sie, junger Herr, dem armen Ding nachgegangen sind. Und dazumal glaubt ich schon, das Kind hätt ein Glück gemacht. Wie sie erzählte, daß Sie gut mit ihr waren, hab ich ihr zugesprochen: ‚Schreib ihm, Laura, geh nicht mehr auf die Gasse. Es ist ein junger Herr noch, er wird sich zu dir halten und acht auf dich haben.‘
Und sie hört ganz still zu und sagt: ‚Wenn du meinst, Mutter Milly, ich wills einmal probieren,‘ und ist wieder ein paar Tage im Bett und bei der Katz geblieben. Zum Schreiben konnt ich sie aber nicht bringen, hab oft den Bogen parat gemacht, aber sie hat nur auf das blanke Papier geweint. Und wie nun einmal auf dieser Welt alles anders geht als man meinen sollt, so ward die Laura grad in diesen Tagen matt und blaß, daß ich erst meint, sie wär in der Hoffnung. — ‚Nein, das wärs nicht,‘ sagt sie, ‚aber es gäb einen Buben mit rotem Haar und dummen Augen, der läg ihr wieder im Sinn.‘ Und wie sie dann einmal dem Wastl, der nach allerlei Gesellreisen heimkam, begegnet ist, hat sie ihn heimlich heraufgeholt und in aller Herrgottsfrühe wieder hinuntergeschickt, daß es keiner merkt.
Aber ich hab einen leisen Schlaf und habs wohl gemerkt, und bin mit meiner Kerze — so dunkel wars noch — zu ihr gekommen und hab ihr die Höll heiß gemacht, daß sies jetzt wo sie einen schönen Herrn haben könnt, mit Spänglerbuben hielt. Aber die Laura hat immer nur mit den Fingern ihr helles Haar gestrählt und geweint und gesagt: ‚Wenns das wär, wenns nur das wär, aber es ist viel schlimmer.‘
‚Was möchtst denn, Kind,‘ fragt ich. — Da hat sie seltsam gelacht und wie eine Hexe ausgeschaut. ‚Ich möcht wohl dies und das und allerlei. Und den Hut möcht ich aufsetzen mit den roten Kirschen und Gassi-Gassi gehen.‘
Und danach hat sie wieder gelacht und hatte rote Wangen. Mich aber hats traurig gemacht, das neue Glück. Zumal sie nun oft mindere Leute heraufgebracht hat. Und ich hatte Not, das Treiben vor den Nachbarn zu verbergen. Da waren oft Bursche bei ihr, die haben ihr nicht einmal was zahlen können. ‚Schenkst du mir nichts, schenk ich dir was‘ hat dann die Laura gesagt und hat mit dem Geld geklappert.
Und gesungen hat sie den ganzen Tag und nicht ein Lied rechtschaffen zu Ende, sondern vielerlei durcheinander. Und auf die Weise von frommen katholischen Gesängen hat sie Gassenlieder gesungen.
Und dazumal ist sie des Abends oft in die Johanneskapelle hinüber gelaufen und wie ich fragt, ob sie denn mit einmal fromm geworden wär, sagt sie: ‚Ich bet zur Herzliebsten Mutter Gottes daß sie mir einen schickt, der so lieb haben kann wie ich lieb hab, und manchmal mein ich, es müßt ein Engel vom Himmel sein; ich wollt ihn auch so besonders karessieren, daß ihm sein Himmel verging.‘
Es ist aber kein Engel vom Himmel herabgestiegen, vielmehr ist eines Morgens der Herr Gendarm heraufgekommen. Mag sein, daß sein Bub es ihm aus Eifersucht gesteckt hat. Der sagt: Er wüßt zwar nichts Gewisses, was die ledige Laura Wunderl trieb, aber wenn er ihr auf die Spur käm, so sollts ihr schlecht gehn. Das gäbs fein nicht, den außerehelichen Firlefanz. Da brauchts einen Schein von der Polizei.
Darauf sagt das törichte Kind, er sollt ihr doch so einen Schein schreiben, wenns den brauchte, und was es kostet. Und darauf der Herr Gendarm, sie sollt acht geben, daß sie nicht eines schönes Tages eingefangen würd und ins Gefängnis hinten am Girgl käm. Und damit schmiß er die Tür ins Schloß.
Und bald darauf wars, daß Sie, junger Herr, die Laura wieder getroffen haben, und haben sie zu sich genommen, wo auch ihre Herren Freunde waren. Und es war lieb, daß sie ihr noch Bücher mitgegeben haben zum Lesen. Da sind sie, ich hab sie zusammengepackt. Sie selbst hat zwar nicht darin gelesen, aber mir hat sie sie in die Küche gegeben, und da ist mir manchen Abend die lange Zeit kurz geworden. Manchmal hab ich ihr auch daraus erzählt. Denn die Laura sagt immer, ‚Geschichten kann ich nicht lesen. Geschichten muß einer erzählen.‘
Aber anstatt, daß sie dann schrieb und wieder zu Ihnen kam, lauert sie immer, ob sie nicht dem Wastl begegnet. ‚Was willst denn mit dem Schandbuben,‘ fragt ich. ‚Ei, ich meine er ist eifersüchtig und bös auf mich. Das ist gut: da lernt er am Ende so lieb haben wie ich lieb hab.‘
Der Wastl aber wich ihr dazumal überall aus und lief andern Mädchen nach. Das sagte mir seine eigne Mutter. Doch einmal hat ihn die Laura erwischt und gleich heraufgeholt. Am Nachmittag wars. Ich saß in der Küche und mir ahnte nichts Gutes.
Mit eins hör ich auch schon den schweren Schritt des Herrn Gendarmen die Stiege herauf. Ich lauf an der Laura ihre Tür und ruf ‚Kind, Kind, tu den Wastl in den Schrank, geschwind, der Herr Gendarm kommt.‘ Antwortet das unvernünftige Kind: ‚Das geht nicht, das geht nicht gut, Mutter Milly,‘ und lacht aus voller Kehle. Und es schellt und es pocht und der Herr Gendarm kommt herein und ich hör, wie in der Kammer der Bub fort will, sich verstecken. ‚Bleib, bleib, mein Schatz,‘ ruft die Laura und ob er schon viel stärker war wie das zarte Kind, so hat sie ihn doch gehalten, ich weiß nicht wie, und hat nicht abgelassen, bis der Herr Gendarm vor ihr stand und fragte: ‚Sind Sie die außereheliche Wunderl?‘
Und so ist sie ins Gefängnis gekommen; und wie es ihr da erging, das hat sie Ihnen geschrieben, wo Sie dann so lieb waren, junger Herr, und haben ihr Geld und gute Grüße geschickt.
Aber denken Sie nur, das Kind war mit einem Mal krank und bös krank. Und es muß der Schandbub der Wastl daran schuld sein. Das hat auch der Herr Doktor gemeint im Spital, wo sie sie dann hingebracht haben, als es schlimmer mit ihr war.
Und da haben sie mich hingeholt; und die Laura hat mir ihre Hand heraufgereicht aus dem Bett und gebeten: ‚Mutter Milly erzähl mir was‘ und ganz hell war ihre Stimme geworden. Hätt man die Augen zu gehabt, man hätt gemeint, es wär ein kleines Kind.
Den andern Tag lag sie im Fieber und war über alle Maßen munter, aber der Herr Doktor meinte, das wär nicht recht und keine Natur, und hatte Sorge, weil sie so ein heiß Herz hat.
Was kuriose Dinge hat das Kind geredet als: ‚Ich hab ein buntes Blut und wenns hervorkommt, ist es weiß. Weiße Blumen hab ich auf meinem roten Mund‘ und ‚die herzliebste Mutter Gottes hat einen blauen Stift genommen und mich angemalt. Bis ich in den Himmel komm, bin ich durchsichtig und schimmerig wie Kristall. Die Engel im Himmel sind alle licht wie Kristall.‘ Und einmal als sie ein wenig Schmerz hatte, sagt sie: ‚Sieben Schwerter im Herzen, ihr Herren, das tut gut. Ich wollt es wären sieben mal sieben.‘
Wie ich nun gestern bei ihr war, sind Herren da gewesen vom Gericht und haben mich befragt, von wegen der Laura ihrem unmündigen Lebenswandel. Und dann haben sie gesagt, sowie sie auf könnt, müßt sie ins Arbeitshaus.
Da war nicht zu helfen, obwohl der Herr Doktor gemeint hat, für den Lebenswandel, für den könnt sie nicht, der käm von einem Nymphenwahn oder wie ers geheißen hat.
Dawider gäbs nur strenge Zucht, meinten drauf die Herren, und ich dürft sie schon ab und an besuchen, aber keine Mannsleut und kein Herrenbesuch.
Wie wir dann wieder allein waren, fragt ich die Laura, ob ich dem jungen Herrn nicht noch einen Gruß und ein gutes Wort von ihr bringen sollt. ‚Was hilft das Grüßen und das Reden,‘ sagt sie drauf. ‚Sie saßen um mich herum, die drei selbigen, und haben auf mich geschaut und gewartet, daß was käm, aber ich konnt ihnen nicht helfen, es geschieht nichts. Die liebe Liebe, sie schickt wohl allerlei Boten, aber sie kommt nicht zu uns. Ich hab auch lange genug gewartet und konnts nicht rufen . . .‘
Und so hat sie fortgesprochen, das irre Kind. Und keinen bessern Bescheid kann ich Ihnen auch nicht geben, junger Herr.“
Das ist das Letzte was ich von der Laura Wunderl erfahren habe.
Von der Mutter Milly aber bekam ich ein paar Wochen später einen Brief: Es wohnte jetzt eine neue bei ihr, eine Kellnerin außer Stellung, und wenns mich interessierte, so sollt ich doch einmal herankommen.
Ich erhalte die Nachricht vom Tode der schönen und vielverehrten Maria Amberg. Sie hatte erst kürzlich ihre Bühnenlaufbahn begonnen, eben ihre ersten Triumphe gefeiert.
Auf einem Feste in einer Villa am englischen Garten erschien sie zum letzten Mal und spielte in einem Melodram Psyche die Titelrolle. Ein Freund, der zugegen war, schreibt mir:
„Sie erhob sich, ins Dunkel tastend, vom Lager und ihre Schleier zitterten vor der Nähe des unsichtbaren Gemahls. Aus jeder neuen Wonne erwachte sie mit ungestilltem Verlangen auf den geöffneten Lippen und der hoffnungslosen Trauer ihrer grauen Augen. Die zuckten grün, als die Schwestern ihr den schlimmen Rat einflüsterten und waren kühl wie Metall, als die verbotene Fackel in ihrer Hand lohte und sie den Leib des Gottes beleuchtete. — Die jähe Wendung, Amors Zorn und Verschwinden nahm sie starr wie ohne Anteil hin. Und als dann die tröstenden Chöre ihre wandernde und endlich anlangende Zukunft verkündeten, spielte ein schier spöttisches Lächeln um ihren Mund: worin später einige Vorherwisser schon den tödlichen Entschluß gelesen haben wollten.
Sie wich dem Beifall eilig aus und war fort. Man wunderte sich über ihr Ausbleiben, suchte sie in der Garderobe, im ganzen Hause, und fand sie nicht. Als das Fest zu Ende war, gingen einige von uns in die frische Morgenluft hinaus zum Aumeister. Bei der Brücke überm Wehr entdeckten wir Maria tot ausgestreckt, die Brust von einem wohlgezielten Schuß durchbohrt.“
Über die Gründe ihres Selbstmordes weiß mein Freund nichts Bestimmtes mitzuteilen.
Nun sind es drei Jahre, daß ich zum letzten Mal mit ihr zusammen war. Ich war noch sehr jung damals, sah staunend an ihrer hohen Gestalt empor und hörte ihren Worten voll Ahnung und ohne Gegenrede zu. Indem ich überdenke, was ich von ihr weiß, bleibt mir ihr plötzliches Ende immer noch rätselhaft und ich kann nichts tun, als ihren Tod beklagen und nebeneinanderschreiben, was ich mit ansah, und was sie mir erzählte. Wer mehr von ihrem Leben erfahren hat, mag aus diesen Bruchstücken sein Wissen ergänzen.
Zum ersten Mal sah ich Marias Gesicht unter den Lorbeerkränzen eines Sängerboudoirs im Halbkreis der Gäste des berühmten Tenors Gaudigl. Franz Gaudigl stand in der Mitte und stellte ein riesenhaftes blitzblankes Grammophon ein. Es schnurrte das bekannte Lied „Ach könnt ich noch einmal so lieben . . .“ und der Tenor spielte pathetische Pantomime dazu. Die bartlosen Männer stießen ruckweis ein heiseres Gelächter aus; die Damen lachten aus voller Kehle, die vom Fach mit bühnenmäßiger Abrundung. Nur die Maria verzog keine Miene. Sie sah ängstlich und festgebannt in die Öffnung des Apparates. Und erst als der wimmernde Wind zu blasen aufhörte, kam wieder ein Lächeln auf ihre Lippen und Glanz in ihren Blick.
Danach ging die ganze Gesellschaft in die Stadt und durch Torbogen und winklige Gassen in ein altertümliches Gasthaus, in dessen Butzenscheiben der bunte Viktualienmarkt und die graue Heiliggeistkirche erschienen. Der Wirt, ein Wiener und Freund der Komödianten, kam an unseren Tisch. Es war ein magerer Mann mit Koteletten an den hohlen Wangen. Er gab uns allen nach der Reihe mit komischer Würde die rechte Hand. In der Linken balancierte er schräg im Kreise ein gewaltiges Kelchglas voll Pilsner Bier. Mit den Damen wurde er bald sehr vertraulich. Nur die Maria sah er schüchtern an und sagte mit demütiger Säufermiene zu ihr: „Gelt, Gnädige, ich bin ein fader Kerl; aber ich hab auch mal hoch hinaus gewollt.“ Er richtete sich straff auf, hob den Riesenkelch mit beiden Händen an den Mund und leerte ihn in einem Zuge bis auf einen schalen Rest, den er wie ein Trankopfer zu Marias Füßen ausgoß.
Einige Monate später im Herbst ging ich an einem Sonntagnachmittag in der Bahnhofshalle auf und ab. Mit einmal stand die Maria vor mir und fragte mich, wohin ich wollte. Sie hatte auf dem aschblonden Haar eine schneeweiße Kappe, rund wie ein Heiligenschein. Als sie mich unschlüssig fand, wo ich den Sonntag verbringen sollte, lud sie mich ein: „Kommen Sie doch mit mir, ich fahre nach Haus zu meiner Mutter.“ Ehe ich noch mein freudiges und dankbares Erstaunen recht ausdrücken konnte, saßen wir im Coupé und sahen zum Fenster hinaus auf das braune wellige Land.
Am Bahnhof der kleinen Stadt wartete die gelbe Postkutsche. Der Postillon grüßte die Maria und fragte, ob wir nicht mit ihm hinunter in die Stadt fahren wollten. Nein, wir gingen lieber zu Fuß. Die Kinder auf der Landstraße und vor den ersten Häusern ließen ihre Spiele, kamen uns entgegengesprungen und reichten der Maria die Hand. Der Fischer unter der Brücke und der Schuster in der dunklen Tür nickten ihr eifrig zu. Wir mußten durch den ganzen Ort und am Storchenturm auf die letzte Gasse vor den Feldern.
Die Mutter stand in der Gartentür. Sie drückte mir fest die Hand. Dann küßte sie die Maria. Ihr braunes verwittertes Gesicht erinnerte mich an die Mutter der Winde in einem Märchenbuch meiner Kindheit. Gleich im Garten sprach sie von Acker, Vieh und Hopfenernte. Dann führte sie uns ins Haus, das der Großvater stattlich aufgerichtet hat. Marias Vater hatte eine Werkstatt angebaut: er war ein Goldschmied. Die Mutter aber, die auf dem Bauernhof geboren und erwachsen war, hat aus dem Anbau Stall und Scheuer gemacht.
Wir saßen in der Stube am breiten Tisch und stellten unsere Füße auf die Querleisten der schrägen Stützen. Die Mutter schenkte Kaffee in große Tassen ein. Maria saß dem Herde zunächst und sah den Bewegungen der Alten geduckt und schweigsam zu, wie ein artiges Kind.
Nach einer Weile erschien in der Tür eine junge Bäuerin, die sie Base Cenzi nannten. Sie hatte die eine Hand auf den vorgestreckten Leib gelegt, an der anderen hielt sie ein Kind. „Grüß Gott beieinander,“ sagte die Base und setzte sich neben mich auf die Bank. Das Kind kroch zu Marias Füßen. Die Base legte beide Arme auf den Tisch und sprach zu der Alten. Sie roch wie ein Feld, auf das nach dem Regen die Sonne scheint. Sie sah der Maria ähnlich, nur war ihr Haar noch bleicheres Blond und ihre Augen waren dunkler.
Die Mutter stand auf und ging an den Herd, das Essen zu bereiten. Das Kind spielte mit der schwarzen Hauskatze. Wir drei gingen hinaus auf die Straße und an den Hopfengärten entlang. Überall waren hohe Stangen aneinandergelehnt, wie die Gewehre auf der Wache. Bei einem Zaun blieben meine Begleiterinnen stehen. „Das ist unser Hopfen,“ sagte Maria zu mir. Beide Mädchen faßten den Zaun an und sprachen von Jahren und Ernten. Ich stand etwas abseits. Der Wind trug mir ihre Worte fort. Im späten Licht erschienen ihre Züge wie gezeichnet, der Schwung der Nase kühner, die schmalen Lippen noch schärfer geschnitten. Die Base beugte den Kopf vor und das Haar wehte ihr in die Stirn. Marias Haupt war zurückgelehnt, die Stirn frei, bleich und eckig.
Beim Abendessen fragte die Mutter nach Marias Studien. Sie erzählte von den Deklamationsstunden: Es wäre immer komisch oder garstig; schön wäre es nie. Aber wenn sie erst mal auf der Bühne stände, würde ihrs schon behagen.
„Theater ist nichts Christliches,“ meinte die Mutter.
„Wenn ich nur wüßt, was ich eigentlich möchte,“ sagte die Tochter und sah zum Fenster hinaus, „auf einer Terrasse sein, mitten in einem großen Fest unter lauter Masken in hellen Kleidern. Und unten müßte Bauernkirmes sein und in der Ferne auf den Feldern Sonnwendfeuer.“
Das wär kein Beruf, meinte die Mutter.
Nach Tisch mußten wir in die Stadt zum Herrn Vetter. Die Hauskatze kam uns erst ein Stückchen nach; als wir aber am Storchenturm waren, kehrte sie um und strich an den Zäunen entlang.
Der Herr Vetter saß in dem Herrenstübchen seines Wirtshauses am Marktplatz und unterhielt seine Gäste. Er begrüßte uns sehr umständlich und fragte so hochdeutsch wie möglich nach vielerlei Dingen, besonders die hohe Politik interessierte ihn. Er erkundigte sich, wieviel Bier pro Tag in Berlin konsumiert würde und teilte seine Reiseerfahrungen mit.
Spät saß ich noch mit der Maria in der Stube bei der Kerze. Maria erzählte: „Ja, früher war ich oft abends beim Herrn Vetter und neben mir der Josef, der mich lieb hatte und zur Frau wollte. Der Josef war Postadjunkt, und es dauerte immer noch lange, bis er heiraten konnte. — Wir haben als Kinder zusammen gespielt. Ich saß still mitten auf der Wiese, und er pflückte mir alle Blumen, die ich wollte, und holte den Ball, den ich weggeworfen, aus den Nesseln und aus dem Sumpf wieder. Und wenn er das Bett hüten mußte (er war viel krank), dann sägte er mir mit seiner Laubsäge feine Kästchen aus hellem Holz. Ich hab noch heute eins davon für meine Seidenbänder. Und als wir größer wurden, schrieb er mir Verse aus Dichtern auf, ganze Hefte voll, später sogar französische und englische mit Übersetzung. Der liebe Junge. Er trug mir immer mein Schulränzel und verehrte mich sehr. Ich war für ihn das Wunder in der Welt.
Es war uns und der ganzen Stadt selbstverständlich, daß wir uns verlobten, als er zweiundzwanzig und ich siebzehn Jahr alt war. Im Jahr darauf saßen wir einmal zur Erntezeit vor einem Heuhaufen. Die Sonne stand dicht über den Hügeln und schien auf unsere Hände. Hinter uns rollten die schweren Wagen vorbei. Singen und Lachen scholl herüber, und wir wußten, oben im Heu lagen die, die sich lieb hatten, beieinander und küßten sich. Der Josef hatte bisher immer nur meine Hände geküßt. An diesem Abend hätte er mich recht gut auf den Mund küssen können; ich hätts ihm nicht verwehrt. Als ich ihm einmal voll ins Gesicht sah, nahm er meine Hand, lächelte und sagte: „Maria, heut hat mir mein Chef mitgeteilt, ich hätte Aussicht auf Beförderung. In zweieinhalb Jahren können wir heiraten, Maria.“ In diesem Augenblick war mir der arme Josef und die ganze Stadt und das Leben hier so zuwider, daß ich jäh aufstand und weglief ohne Abschied. Am nächsten Morgen sagte ich zur Mutter, ich könnte nicht länger bleiben, entweder wollte ich aufs Dorf zu den Basen oder noch lieber nach München, was lernen. Die Mutter beriet mit dem Herrn Vetter und dann haben sie mich nach München gelassen. — — Der Josef aber ist gestorben, ehe die zweieinhalb Jahr um waren, und liegt hier auf dem Kirchhof begraben ganz nahe bei meinem Vater, ist nur ein Fleckchen Gras dazwischen.“
Es war Mitternacht, als wir wieder im Coupé saßen. Maria erzählte von ihren Basen auf dem Dorf: „Wenn ich die Cenzi ansehe,“ sagte sie, „fühle ich manchmal was wie Neid. Sie hat ihre Arbeit und ihr Kind, hat Alltag und Sonntag, die langen dumpfem Winterabende in der Stube, den langen lichten Sommermorgen auf dem Feld, und auf der Kirchweih ist sie die schönste.“
Dann schwieg Maria und in der Dunkelheit, die das kleine Lämpchen über uns mit seinem dürftigen Lichtkreis nur berührte, wurden die Minuten zu Stunden. Zuletzt kam wieder Marias Stimme aus der Nacht: „Ach daß man nicht einfach da sein kann, über Land gehen, wenn die Sonne scheint, am Fenster sitzen, wenns regnet.“
„Sie sind ein guter Begleiter, kommen überall mit und hören alles still an, was man vorbringt,“ sagte Maria zu mir, als wir an einem milchblassen Novembertag im Schloßgehöft von Schleißheim standen. Die Fohlen kamen an den Zaun gesprungen, um von ihrer Hand gestreichelt zu werden. Sie führte mich in die kleine eingebaute Kapelle, wir saßen nieder vor dem Altar und sie sagte:
„Auf dieser Bank hat oft ein Mädchen gekniet, eine Tochter hier aus dem Schloßgesinde, die da drüben hinterm Gitter zu ebener Erde wohnte. Sie hat für mich mitgebetet, die Rosel, und ganz glücklich war sie im Marienmond, wenn ich bisweilen mit ihr in die Maiandacht kam. Täglich besuchte sie mich in meinem Garten und paßte immer die Zeit ab, wo mein Freund mich allein ließ. Wir nähten zusammen und spannen sogar und hatten immer allerlei Frauenwerk unter den Händen. An sonnigen Nachmittagen, wusch sie mir am Brunnen mein Haar. Sie saß zu meinen Füßen, während es in der Sonne trocknete, und im Abendlicht flocht sie mirs.
Aber die Eltern konnten sie nicht mehr miternähren und schickten sie in die Fremde, Dienst zu suchen. Sie saß den ganzen letzten Abend bei mir und weinte. — Ihre Augen waren braun wie Kastanien. Ihre harten Hände waren klein und geschäftig. Von den Männern wollte sie nichts wissen, ihr war vor allen bange —. Ich hab sonst nie eine Freundin gehabt in meinem Leben. Die Frauen sind mir nicht gewogen.“
Wir gingen durch die kahlen Kastanien-Alleen des Parks und als wir zu den großen Brunnenbecken kamen, fing Maria wieder an zu erzählen:
„Diese Brunnen sind immer leer. Nur einmal sah ich die Wasser springen zu einem Fest. Da erschienen hier im Garten Rokoko-Perrücken und Reifröcke, und es wurde vor Kurfürst und Kurfürstin ein schäferliches Menuett aufgeführt. Aber ein Regen fiel: die Lämmchen, die die Bäuerinnen am Seil hielten, trieften und ihre rosa Öhrchen zitterten.
In den Sälen wurde getanzt und ich nahm zu jeder Tour einen anderen Tänzer. Aber sie schwatzten mir zuviel galantes Zeug vor, vielleicht um ihren Kostümen gerecht zu werden. Und mit einmal schämte ich mich meiner Maskengarderobe und lief in den naßen Park hinaus. Der Regen fiel wie Peitschenschlag auf meine Schultern. Es jagte mich übers rote Laub vom Vorjahr weit weit bis zu der Blutbuche: unter der blieb ich sitzen und mußte weinen, unablässig weinen. So fand mich mein Freund. Ich konnte nicht sagen, warum ich traurig war.
Indem hatte der Regen nachgelassen, aus den Marmorpfannen vorm Schloß sprangen Naphtafeuer auf und rings um Teich und Brunnen leuchteten bengalische Flammen. Die bunten Fetzen einer wilden Tänzerschar flackerten im Schein geschwungener Fackeln. Aber für mich war es zu spät, ich konnte nicht mehr zu den anderen, ich schlich heim unter tropfenden Zweigen.“
Nun wollte Maria mir erst das Haus und den Garten zeigen, wo sie damals gewohnt hatte, und ihren Balkon mit dem ‚Tausendblätterdach‘; aber von ihren eigenen Worten war sie zu traurig geworden. Wir gingen durch die Schloßhöfe zurück und wollten gerade zur Bahn, als wir vor einem Haus einen langen mageren Herrn im Sportsanzug an einem Automobil beschäftigt sahen. Maria begrüßte Herrn Aldermann und beide plauderten von den alten Zeiten. „Sie haben schlechte Farbe, Maria,“ sagte er, „steigen Sie mal gefälligst gleich in meine Karre, meine Herrschaften, und lassen Sie uns ein Stückchen die Dachauer Chaussee hinauffahren, daß wir merken, es weht noch ein Wind durch die Welt. Sie müssen nicht immer alten Dingen nachhängen, Maria. Sport treiben, Ski im Gebirge und radeln und Golf und Tennis, das macht Blut und vertreibt dumme Gedanken.“
Er nötigte uns, einzusitzen, und lenkte das Gefährt erst langsam an der Häuserreihe hin; kaum aber waren wir über die Brücke, so ließ er es mit großer Geschwindigkeit sausen. Maria hielt die Hände an die Schläfen und sah erstarrt auf die Birkenreihe, die an uns vorübertaumelte. „Halt, halt,“ schrie sie nach zwei Minuten Fahrt, „nicht weiter, das ertrage ich nicht. Mir fallen ja alle Bäume vor Augen um.“ Aldermann stoppte, er konnte sich vor Lachen kaum halten. Wir stiegen wieder aus und sie reichte ihm mit kümmerlichem Lächeln die Hand. „Ich fahre weiter,“ rief er, und war im Nu von dannen.
„Dieser moderne Herr,“ sagte Maria, als wir wieder allein waren, — „er ist übrigens Künstler, macht Lithographien im Plakatstil und will von der Ölmalerei nichts mehr wissen — der hatte einen jüngeren Bruder, einen zarten schwindsüchtigen Menschen, der nur ein paar mal heraus zu Besuch kam. Mit dem ging ich unter diesen Birken spazieren im Herbstlicht, wo alle Farben sich lösen. Mein Kleid war bunt, wie der Boden unter mir und seine Wangen fahl und farbig wie die Ferne. Er sprach nur wenig Worte und doch hatte ich, so oft ich ihn ansah, das Gefühl, er wüßte meine Gedanken. An seiner Seite war mir so leicht, als könnte ich über dem Sumpf im Nebel schweben, nur von den eigenen Schleiern getragen. Und vor seinen Augen löste sich die ganze Welt in ein Farbenspiel auf. Er war kein Künstler. Manchmal, wenn er mir die Hand reichte, wenn sich nur unsere Fingerspitzen berührten, zuckte es, als schlüge ein Funke zwischen uns. Aber er ist ohne Abschied fortgegangen und ich habe ihn nicht wiedergesehen.“
So sehr mich Maria anzog, mir war nicht wohl zumute an ihrer Seite. Was wollte sie von mir, daß sie mir erzählte was sie älteren Freunden verschwieg? Warum fragte sie nie nach meinem eigenen Leben und hielt meiner jungen Gegenwart immer diese viele Vergangenheit entgegen? Ich wurde nicht glücklich von ihrem Vertrauen. Eine Zeitlang vermied ich, sie zu treffen, bis wir uns eines Abends in einem Konzert Seite an Seite fanden.
Es war auf der Gallerie des Odeons im dunklen Winkel neben den blinden Knaben. Sie nahm meine Hand mütterlich in ihre Hände und flüsterte mir zu: „Hier ist gut sein, hier neben denen, die nur hören und leere Augen öffnen. Aber sehen Sie dort den Mann —.“
An einem Pfeiler vor uns lehnte ein plumper Riese, der sein fleischiges Gesicht zu einem krampfhaften Lächeln verzogen hatte und mit der steigenden Fuge immer mehr verzog. Und als der Satz weiter wuchs und wuchs und nicht abschließen wollte, faßte er wie ein Ertrinkender in die Luft und seine Kniee wankten. Bei einem anderen Stück, wo das Thema durch viele Verwandlungen wiederkehrte, lachte er böse auf und winkte wie geärgert ab. In der Pause brach er ganz erschöpft in einer Ecke zusammen. Irgend ein Bekannter, der herzukam, kannte diesen seltsamen Menschen, holte ihn aus seinem Winkel und stellte ihn der Maria vor.
„Sind Sie Musiker?“ fragte Maria.
„Eben nicht,“ erwiderte er heftig, „eben nicht. Ich bin Kaufmann, jawohl, und nicht mal ein guter Kaufmann. Aber dies da, meine Dame (und er zeigte auf das Orchester), das ist mein ganzes Erlebnis.“
Er lachte derb. Der Bekannte der ihn hergebracht hatte, glaubte vermitteln zu müssen und erklärte, auch er kennte kein reineres Glück als die Musik.
„Glück?“ rief der Kaufmann, „nicht die Spur. Es ist eine Qual. Ach es ist ja so lächerlich: Ich weiß immer, die Lösung kommt ja doch zuletzt. Die alten Halunken, sie können sich stellen, wie sie wollen, können die kleine Melodie verdrehen und umwickeln, daß sie schier verschwindet. Aber dann kokettiert sie doch wieder von ferne, und mit einmal ist sie da und — und tut unschuldig wie ein braves Schulkind, das was hersagt. Und tut als wüßte sie nicht, wie sie uns zittern macht. Und wenn wir schon die Augen schließen, weil wir sie endlich haben, ist sie wieder fort und das qualvolle Spiel beginnt von neuem. — Das ist eine Sache, die Musik: ein ewiger Selbstbetrug, als ob ich erlebte, ich selbst und weiß wie das Kind beim Märchen, es muß gut ausgehen. Ein Schwindel die Kunst, — aber das einzige, was ich habe.“
Er ging an seinen Platz zurück, um wieder zu wanken unter den Tönen und über sich und alles zu lachen.
Aber Maria wollte fort, ehe das Konzert aus war. Sie zog mich mit und draußen auf dem düsteren Platz sagte sie: „Ich wollte, er hätte nicht gesprochen. So lange ich ihn nur ansah war er wunderbar. Nun scheint er mir auch nur feig und lüstern, wie so die Menschen sind.“
Wir kamen ins Café. Von einem Sofa erhob sich ein kleiner runder Herr mit grauem Kraushaar um den kahlen Scheitel, um uns zu begrüßen. Als Maria ihn sah, nickte sie ihm flüchtig zu, drehte um und ging zur Tür zurück.
„Warum weichen Sie dem Herrn aus,“ fragte ich, als wir wieder auf der Straße waren.
„Den kann ich heute nicht sehen. Oft habe ich schon von den anderen genug, die nur mein Leben verehren, aber der, der verehrt meinen Tod. Kennen Sie ihn nicht, den berühmten Robert Mark mit seinen Teppichen und Ampeln und Märchen und schönen Frauen. Zwischen Sträuchern und Bäumen eines verwilderten Gartens steht sein Haus. Ein Negerkind klopft dreimal mit dem Türklopfer ans Tor, wenn man in den Garten tritt. Ein verschrumpftes Mongolenweib öffnet und leuchtet mit silbernem Leuchter die Treppe hinauf zum Saal. Da drinnen wird einem ganz taumelig von östlichen Kräutern und schwüler Kerzenhelle mitten im bunten Dunkel. Da lagert rings allerlei Frauenzimmer und Mannsvolk auf Polsterkissen vor japanischen Götzen und unter alten Gobelins. Und er selbst geht von Gruppe zu Gruppe und mit seinen fetten gepflegten Händen begleitet er die Bewegung seiner Gäste. Alles was sich da regt, Gebärde, Wort und Gedanke wird sein Werk. Und er betrachtet uns alle mit der Lust des Schöpfers, obwohl er doch bloß der Arrangeur ist.
Im Anfang zog er mich sehr an. Ich dachte bei ihm das Fest zu finden. — Und dann, wir Frauen brauchen bisweilen Teppiche, die unseren Schritten gebreitet sind, und verehrende Hände und Gleichnisse, die uns bekleiden. Wir wollen auch ein Schauspiel sein. — Aber er bekleidet uns wie Leichen, wie totenhaft aufgeputzte Kinder. Er schlürft wie einen seltenen Wein unseren Augenblick, unsere Gegenwart und fragt nach keinem Vorher und Nachher. Aller Streit, Widerspruch, Konflikt wird lächerlich vor seinen Brauen.
Wenn ich sehr müde bin, habe ich manchmal Sehnsucht nach seinen Kissen und Tüchern und schläfernden Erzählungen wie sich andere nach Opium sehnen. — Nein, lieber Fritz, zu dem führe ich Sie nicht. Sie werden ohnehin einmal von irgend einer seiner Schönen als Page oder Ritter mitgenommen werden zu diesem berühmten Frauenkenner, diesem Verehrer, der Totenkult treibt mit den Lebenden. Und jetzt wollen wir froh sein, durch klare kalte Nacht zu gehen.“
Ein Winternachmittag im englischen Garten. Das Gras bereift. Die Luft voll Dunst.
Maria, die sonst immer lieb und langsam von Baum zu Baum wie von Freund zu Freund ging, glitt heut fremd an dem grauen Gesträuch entlang. „Frieren Sie?“ fragte ich und hing ihr meine große Lodenkapuze um. „Laufen wir immer weiter in den Abend,“ war die Antwort, „ich bin nicht gut mit mir heut.“
Im Aumeister tranken wir Glühwein und Maria gab mir ihre Hände zu wärmen. Lang und hager waren diese Hände, wie die eines emsigen Jünglings. Die Linien stark unterbrochen, die Fingerwurzeln hoch gewölbt. Man konnte lange hineinschauen, aber ohne die innige Sehnsucht, sie an die Lippen zu drücken. Und wenn man sie küßte, waren sie kühl, wie die Zehen der Heiligen in den Kirchennischen.
Es war Nacht, als wir an die Brücke überm Wehr kamen. Maria lehnte sich an das Geländer und schaute in das schwarze Wasser. Da trat der Mond aus den Wolken. Ängstlich, wie belauscht sah sie nach ihm um und ging weiter.
Auf dem Heimweg über Feld und Landstraße, war sie so schweigsam, daß mir fast vor ihr bangte. Deshalb fing ich ein Gespräch an über einen Gegenstand, den sie sonst gern besprach, über das Träumen. Aber davon wollte sie nichts hören.
„Träume,“ sagte sie und schüttelte den Kopf, „Träume saugen an unserem Blut und trinken uns unsere beste Liebe vom schlafenden Munde weg — Ja freilich gibt es auch harmlose. Die sind eine armselige Gerechtigkeit der Natur. Da setzt sie uns als Ersatz vor, was wir im Leben grad nicht haben, dem Übermütigen warnende, dem Traurigen Trostträume. Will ich zu hoch hinaus, so bekomme ich allerhand Braves zu träumen. So habe ich jetzt immer einen Traum von meinem Bräutigam in der Heimat, dem verstorbenen: stumm lächelnd nimmt er meine Hand und führt mich in eine bunte Bauernkirche. Und am Altar steht der Herr Vetter als Pfarrer und segnet uns mit dicken Fingern ein. Und danach sitze ich an einer großen Hochzeitstafel mit viel zu viel Braten und ringsum pappige Bürgerfräcke und weißgewaschene Kleider.
Ich habe auch bisweilen von dem kleinen polnischen Maler geträumt, der mich immer zur Zigarette und Seelenlosigkeit überreden wollte. „Ist Irrtum Seele, ist bei mir gute Parfum und türkische Kaffee. Kommen Sie zu mir.“ Warum habe ich nicht Zigaretten geraucht bei dem Polen, warum bin ich nicht Frau Postadjunkt geworden? Manchmal denke ich, das wäre alles gegangen. Da hätte ich doch allerlei erlebt, wie es die anderen erzählen. Herzelust und Herzeleid, Sünde, Schicksal, wie in den Liedern, alle diese bestimmten Dinge.
Nun muß ich in den Wind laufen, um Widerstand, und muß Verse der Dichter lernen, um mich hingeben zu können. Mein Blut läuft so kühl, kühl wie ein Wasser durchs Land läufts in mir. Und so möchte ich wohl ein kühl Wasser sein und nichts wissen als mein Weiterfließen. Aber warum treibts mich immer wie zu einem Ziel. Und ich habe doch kein Wohin? Ist das ein Heimweh? Und ist am Ende noch eine Heimat hinter Elternhaus und Stadt und Dorf? — Manchmal ist es die Almwiese, wo die faule Magd damals den ganzen Tag im Heu blieb und mochte nichts essen noch trinken, noch arbeiten. Und mochte nimmer heim. Und weil sie nicht recht im Kopf war, ließ man sie gewähren. Wie wir sie den anderen Abend fragten: Wer war denn bei dir? — „Die Großmutter Garnwicklerin,“ sagte sie, „und die Ältermutter war da und noch eine greise, greise Mutter, die ich nicht kannte. Die waren beieinander über mir im Heu, und sie aßen von einem großen Breiteller mit langen Löffeln. Und das gab einen so süßen Geruch von Heu und Brei. Davon ward ich ganz satt —.“
Der berühmte Ruhland wollte Maria radieren. Von der zweiten Sitzung ab mußte ich sie begleiten. Er arbeitete so emsig und unheimlich, sagte sie, sie könnte nicht allein mit ihm sein.
Der Künstler warf mir einen bösen Blick aus trüben Augen unter buschigen Brauen zu, als ich zum ersten Mal über seine Schwelle trat. Dann reichte er mir mit verbindlichem Lächeln die Hand.
An einem Abend mitten in der Karnevalszeit arbeitete er bei Licht. Sein Pult war von zwei Kerzen erhellt. Die nervigen Hände zitterten über der Kupferplatte. Maria saß steil aufrecht unter einer verschleierten Lampe. Ihre Finger froren mitten in dem warmen Dunkel ihres Samtschoßes. Es froren rote Flecken auf ihren Wangen. Er arbeitete rastlos und stumm. Sie flüsterte mit mir und sah mich an. Aber ihr Blick blieb nicht in meinen Augenhaften, griff weiter ins Raumlose.
Die Zeit ging hin. Ich wurde todmüde, zumal ich die Nächte vorher vertanzt hatte. Und da diese gespenstige Sitzung immer noch kein Ende nehmen wollte, so sagte ich, ich müßte ein wenig ruhen, legte mich auf den Diwan in der Ecke und verfiel in einen Halbschlaf. Wie aus weiter Ferne hörte ich nun die beiden sprechen. Er bat inständig und sie antwortete leise. Im Tiefereinschlafen hörte ich Kleiderrascheln. Schritte, Marias Schritte kamen näher, sie war über mir, sie legte etwas Weiches auf mich: es war ihr Samtkleid. Mir wars, als trüge ich in diesem Kleide ihre Gestalt im Fluge sinkend in eine unendliche Tiefe.
Eine Hand, die mein Haar streichelte, weckte mich auf. Ich schlug die Augen auf vor Marias blendender Brust. „Du bist lieb mein Kind,“ sagte sie, „vor deinen Blicken schäme ich mich nicht.“ Aber da ich mich selbst sehr schämte, ja zu weinen fürchtete, wie ein armes Kind vor den glänzenden Schätzen hinterm Schaufenster, die es nie besitzen wird, so fielen mir die Augen wieder zu.
Am Morgen wachte ich auf im kahlen Atelier, und Ruhland kam im Schlafrock lachend und Pfeife rauchend an mein Lager.
Zu Haus aber fand ich einen Zettel von Marias Hand. „Mit dem Modellsitzen ist es nun aus, ich hab genug von den Künstlern. — Ach lieber Fritz, wie bin ich all der stummen und lauten, heimlichen und unheimlichen Freier müde. Nur nach dem einen Fest sehne ich mich noch, wo alle mit allen tanzen.“ Davon verstand ich nichts und das machte mich traurig. Der Karneval verging und die halbe Fastenzeit, ohne daß ich Maria wiedersah.
Da an einem trüben Märzmorgen erschien sie plötzlich bei mir. Es war das erste und einzige Mal, daß sie mein Zimmer betrat. Sie war in einem hellen Frühlingskleid. Den grauen Wintermantel trug sie überm Arm. In der Hand hielt sie eine Pappschachtel: „Da habe ich allerlei Karneval drin. Ich will mich putzen. Wir wollen feiern. Ich will nun auch feiern. War so lange eingesperrt.“
Ich nahm ihre Hände: „Aber Maria, die Feste alle sind vorbei.“
Ihre Augen flackerten, sie lachte: „Mir ist ein bißchen wüst im Kopf, Fritz. Ich bin zu viel allein. — Aber nun wollen wir den lieben Plunder auspacken.“
Wir knieten und die Schachtel ging auf: Bunt quoll es heraus: Tücher, Schleier, Agraffen, Gürtel und Ringe. Da blinkten Perlen, groß und gläsern. Blechspangen klapperten und Goldborten flimmerten viel zu grell. Marias Antlitz war totenblaß über all dem lustigen Flitter.
Zum letzten Mal sah ich die Maria an einem Vorfrühlingstag. Vor meinem Fenster fegten Wolken an der Morgensonne vorbei und dann riefs unten meinen Namen. Maria stand auf der Straße im hellen Mantel. Um Kappe und Kinn hatte sie einen Schleier gebunden. „Schnell auf und heraus mit Ihnen,“ rief sie, „wir laufen ins Isartal.“
Wir eilten durch die Straßen bis hinunter zu den Brücken. Der Wind war noch sehr kalt, die Sonne stach schon heiß. Flußaufwärts gings gegen den Wind. Wir sprachen kaum ein Wort.
Hinter der Schwaige warf sie sich an einem Abhang ins Moos bei grauen Herbstbüschen und dünnen grünen Gräsern. „Die sind wie Säuglingshaar“, flüsterte Maria und strich zaghaft darüber hin.
Und bei dem beständigen Rieseln und Dunsten der angeschwollenen Gewässer wurde ihre Stimme erregter: „Das Leben ist so jung heut. Gras und Ast schauert in der Luft wie kleine Kinder im kalten Bade.“ Sie gab mir ihre Hand, in der das Blut in heftigen Schlägen und langen Pausen zuckte.
Wir gingen weiter. Auf der großen Eisenbahnbrücke blieb sie einen Moment stehen und sah in die steile Tiefe hinab. Drüben kamen wir in den Wald. Die Bodenwellen glitten unter uns auf und ab. Die kahlen Buchenstämme glänzten. Es gab schon frühe Kätzchen an hellrotem Stiel.
Wo der Wald zu Ende war, führte der Weg in steilen Serpentinen den Hang hinaus zur Terrasse. Nach den ersten Schritten stockte Maria: „Wie müd ich bin.“ Ich stützte und schob sie langsam vorwärts. Das ließ sie gütig zu und lehnte sich an mich. Unter dem Mantel fühlte ich die Seide der Bluse heiß von ihrem Blut. Wie eine schwere Gnade lag ihre ganze Gestalt auf mir.
Über die letzte Ecke des schlängelnden Weges hing ein dichtes Gesträuch nieder und hemmte unsern Schritt. Ich hob den freien Arm es zurückzubiegen, und da lag Maria ganz an meiner Brust, und ich küßte sie plötzlich auf die kühlen zuckenden Lippen. Sie lächelte. Sie streichelte meine Wangen. „Du sollst froh sein und küssen, wenn ich nicht mehr bei dir bin. Ihr Künftigen sollt wieder froh sein und sollt euch mit Lachen und Spielen lieben. Wir konntens noch nicht. Wir haben unser Haus verlassen und irren nun ohne Wesen wie Gespenster. O, Kind, Kind! Du weißt das nicht. Vielleicht ist es auch nur ein Frauenleid, wovon ich spreche. Uns ist nicht gut, wenn wir aus dem Dumpfen auftauchen, das Licht macht uns krank.“ Und sie neigte sich und küßte meinen Mund. Eiskalt war ihr Kuß.
Als wir dann auf der Terrasse saßen und weit über Land sahen, sagte sie nach einigem Schweigen: „Lieber Fritz, Sie gehen nun fort und wer weiß, ob wir uns wiedersehen, ob ich noch da bin, wenn Sie wiederkommen. Und dann werden die Leute viel Dummes und Eitles über mich schwätzen: Ich wäre zu stolz gewesen, preziös, lebensfremd, oder wie all die Worte heißen. An Gelegenheit zum einfach glücklich sein hats mir nie gefehlt. Ich könnte alles haben, wenn ich nicht so traurig wäre. Viele haben mich geliebt, und wo ich begehrte, habe ich auch genossen. — Ich werde nun wohl auf die Bühne kommen. Gelernt habe ich, Protektion habe ich. Ein wenig lockt mich auch das falsche Licht und die Unruhe des scheinbaren Schicksals. Aber irgend wie lohnt das alles nicht. Und zu allem fehlt mir irgend ein Segen, irgend ein Recht.“
Sie sah mir in die Augen: „Sie haben mir immer so still zugehört, nicht so rasch verstanden, nicht ausgedeutet wie die andern. Es ist mir leid, daß Sie fortgehen: Leben Sie wohl.“
Sie stand auf und küßte meine Stirn: „Leben Sie wohl. Ich muß noch allein weiter laufen in den Wind und kahlen Wald.“
Am Tage darauf verließ ich die Stadt und bin nicht wiedergekommen. Von Maria habe ich nur selten gehört durch Bekannte, die ihre glänzende Gestalt auf der Szene oder auf Festen erscheinen sahen. Am meisten liebte sie die Festaufführungen im Karneval, und solch eine war das Psychespiel, mit dem sie von der Welt Abschied nahm.
Begraben wurde Maria Amberg auf dem Friedhof ihrer Heimat zwischen den Gräbern des Jugendbräutigams und des Vaters.
Sie hat einen Spirituskocher und die Beethovenmaske. Die Wände ihrer Kammer sind mit grünem Rupfen bespannt, und das schräge Dachfenster, das den Raum zum Atelier macht, ist mit einem verhältnismäßig weißen Nesseltuch verhangen. Dieser Vorhang schließt allerdings nicht mehr ganz, so sehr sich Peterchen bemüht, ihn mit ihrem Malstock zuzuschieben, und so kann der Tag immer ein wenig hereinlugen.
Aber wenn dann die Dämmerstunde kommt, verschwimmt die störende Spalte mit der Umgebung und alles ‚geht gut zusammen‘, wie die Maler sagen.
Um diese Zeit setzt Peterchen Wasser aufs Feuer für den Tee und erwartet ihre Gäste. Sie hat immer viel Besuch. Obwohl von den andern manche weit mehr Raum haben und nicht so hoch in der Dachluke hausen, kommt man doch am liebsten zu Peterchen, Tee trinken. Bald sind alle Sitze besetzt: Auf dem Schlafdiwan ein Schriftsteller zwischen zwei Malerinnen. Auf dem Feldstuhl ein Musiker. Ein Kunsthistoriker auf dem Schemel am Ofen. Die lange Cora schiebt die beiden großen Polsterkissen gegeneinander, lehnt ihren Tituskopf zurück und ruht. Peterchen selbst aber liegt auf dem Fell vorm Diwan und reicht den Freunden Tee und Zigaretten.
Sie heißt eigentlich Else Petersen. Als sie nach München kam, nannte sie sich sogar Elsa. Die lange Cora sagte eine Zeitlang Lisbeth zu ihr; aber daran konnten sich die andern nicht gewöhnen. Sie brauchten was Kleineres. Und so hieß sie eines Tages Peterchen. Niemand wußte, wer sie zuerst so getauft hatte.
Immer gibt es bei Peterchen was zu essen und zu trinken. Wie sie mit ihrem schmalen Wechsel so gut haushalten kann, bleibt den andern rätselhaft. Wenn einer kein Geld mehr zum Abendbrot hat, kommt er zu ihr, und sie kocht ihm einen ganzen Schmaus auf ihrer Spiritusflamme.
In ihrem Schrank sind stets noch ein paar Datteln und Nüsse, etwas Milchschokolade und Bäckerei, die ein wenig nach der Schublade schmeckt. Im Winter schmoren Bratäpfel auf dem Kochofen. Und immer hat sie Vorrat an Tee, Kaffee, Butter und allem was eben Not ist. Also daß man ihre Truhe dem Ölkrüglein der biblischen Wittib vergleichen möchte, zumal Peterchens junges Leben schon von einer Art Witwentum verschleiert ist, wenns auch nur ein Traumglück ist, was sie verlor.
Peterchen war nicht von jeher zufrieden gewesen, mit Stillsitzen und Teekochen. Es gab eine Zeit, da hatte sie es auf das Leben selber abgesehen.
Sie ist aus einer kleinen Stadt an der Ostsee und hat schon als Schulmädchen bei Fräulein Döpperling in der Domstraße das Blumenmalen erlernt. Onkel Ferdinand, das Haupt der Familie, der sich in seinen Mußestunden für Kunst interessierte, eine Loge im Stadttheater hatte und bisweilen mit gastierenden Schauspielern dinierte, nahm lebhaften Anteil an dem Talent seiner jüngsten Nichte und war durchaus dafür, daß man sie später nach München schickte. Der Vater, der selbst nie auf einen grünen Zweig gekommmen war, gab in allen Familienangelegenheiten dem ältern Bruder nach. Onkel Ferdinand hatte die drei älteren Schwestern gut untergebracht: eine war Lehrerin, die andere Erzieherin und die dritte Buchhalterin in einem großen Geschäft. So blieb nur die kleine Else. Für die wollte er ein übriges tun.
Und sie malte und malte und wartete auf München.
Sie malte alles ab, ihre Stube in sämtlichen Beleuchtungen, die Schwestern im Garten, den Vater abends bei der Lampe. Bei den Sonntagsspaziergängen der Familie hatte sie immer das Skizzenbuch für alle Fälle mit, und an freien Nachmittagen ging sie mit Gerät über Land und malte Mühle, Bach und Busch. Und wenn sich dann ein Primaner oder ein junger Mann ihrer Staffelei nähert, warf sie ihm einen so entrüsteten Blick zu, daß er entmutigt weiterging. Er konnte sich aber auch denken, daß man keinen Kleinstadtflirt brauchte, wenn man später nach München durfte.
Als sie dann noch ein halbes Jahr Selekta durchgemacht hatte, ohne die Liebe eines Lehramtskandidaten zu erwidern, der um ihre Hand anhielt, kam sie endlich endlich im Herbst nach München.
Mit klopfendem Herzen legte sie dem Meister eine Auswahl ihrer besten Arbeiten vor. Ihr Fleiß fand Anerkennung, und sie wurde in die Malschule aufgenommen.
Die erste Zeit wanderte ihr Blick nur von der Leinwand zum Modell und vom Modell zur Leinwand. Und im Abendakt zeichnete sie den Körper eines jungen Burschen mit so strenger Sachlichkeit ab, daß der Meister bei der Korrektur eine Weile hinter ihrem Schemel stehen blieb und ihr lächelnd zusah. Er mochte sie überhaupt sehr gern, nannte sie kleines Fräulein und liebes Kind. Und die andern folgten seinem Beispiel und verwöhnten Peterchen. Die jungen Maler boten ihr Zigaretten an und sahen schmunzelnd ihren Rauchversuchen zu.
Die lange Cora nahm sie in der Pause auf den Schoß und lud sie zu sich zum Abendbrot ein. Und wenns dann spät wurde, wollte sie sie nicht fortlassen, sie sollte bei ihr schlafen. Sie wollte sie auch schöne Phantasietänze lehren, die sie sich in einsamen Nächten ausgedacht hatte. Und sie tanzte ihr vor und warf den Kopf in den Nacken, wie die Mänade auf dem Relief an der Wand.
Aber das Leben selber wollte sich noch nicht einstellen und Peterchen beschränkte sich einstweilen auf die neue Weltanschauung.
Zu Weihnachten fuhr sie nach Hause, fühlte, wie viel sie nun von ihren Angehörigen trennte, und berichtete darüber an Cora.
Die Familie wunderte sich über ihre eigentümlichen Beobachtungen und erfuhr, daß es in der guten Stube kalte und warme Töne gab. Sie redete bei Tisch von den Japanern und verdroß Onkel Ferdinand, der doch auch etwas von der Kunst zu wissen glaubte, indem sie weder von Rafael noch von Meissonnier, sondern von lauter Unbekannten sprach. Einmal erschreckte sie auch den guten Vater durch eine freie Äußerung auf moralischem Gebiet. Er zog daraufhin den Onkel zu Rate. Aber der beruhigte ihn mit überlegenem Lächeln: Er war Kenner, hatte auch einmal „gelebt“ und sah es jedem Mädchen an, wie weit sie war.
Als Peterchen wieder nach München kam, hatte der Karneval schon angefangen. Ihr Debut war ein Atelierfest in Phantasiekostümen. Sie riß ein Stück ihres grünen Rupfens von der Wand und bekleidete sich. Durchs Haar wand sie natürliche Blumen. Es wurde zwar sehr wild getanzt, aber da der Stil auf dem Programm stand, beschränkten die Faune, Panisken und Waldschrate ihre mythologischen Vorrechte auf künstlerische Andeutungen.
Zuletzt führte Cora Solotänze auf zur Flöte eines am Boden hockenden Jünglings. Man trennte sich um vier Uhr nachts. Es war schön gewesen. Aber eigentlich hatte sich Peterchen den Karneval doch etwas anders gedacht. Man würde alles vergessen, hatte sie gemeint, man würde leben.
Diesem Bedürfnis mochte eher der Bauernball entsprechen, zu dem Peterchen sich holländisch kleidete. Der kleine Paul Dühren, den sie bei Cora kennen lernte, gab ihr die Haube und die Nadeln. Von ihrer Zugeherin bekam sie den roten Rock.
Sie ging an Coras Arm durch die festliche Dämmerung des Saals und die Menschenmassen und dann die Treppe hinauf zu den Tischen.
Oben saßen in einer Ecke ein paar Fuhrleute in blauen Kitteln und tranken Sekt. Sie winkten die Mädchen heran, und der größte von ihnen gab Peterchen aus seinem Glase zu trinken. Während sie trank, setzte er sie ganz einfach auf sein Knie, und redete mit den andern. Seine Stimme war ihr unangenehm. Sie sah zu Boden, um nicht dem scharfen Blick seiner Augen zu begegnen. Sie mußte immerzu seine Lackschuhe und durchbrochenen Seidenstrümpfe betrachten, die unter den wüsten Fuhrmannshosen elegant und verwundert hervor schauten.
Als er das Gesicht wieder zu ihr wandte und mit ihr sprach, fühlte sie, wie ihr das Blut zu Kopf stieg. Mit einmal hob er sie auf und trug sie die Treppe hinunter in den Tanzsaal. Er tanzte sehr korrekt und leicht und hielt das ganze Peterchen mit drei Fingern fest. Als aber der Tanz zu Ende war, küßte er sie mitten auf den Mund und lachte.
Da lief Peterchen weg, lief in den Nebensaal, setzte sich unter den Maibaum und schämte sich.
„Bist du traurig, Meisje?“ fragte der kleine Paul Dühren, der hinzukam.
Sie blickte auf: „Was ist Meisje?“
„Na so heißt Mädchen auf holländisch, und du bist doch ein holländisches Mädchen!“
Ach ja, sie war eine Holländerin, und es war Karneval und im Karneval brauchte man sich auch nicht zu schämen. Nun wollte sie wieder lustig sein und tanzen.
Sie tanzten zusammen. Sie waren von derselben Größe. Und weil gerade ein Ländler gespielt wurde, legte er ihr die Arme ums Mieder und sie mußte die Hände auf seine Schultern legen. Eine strohblonde Strähne fiel ihm beim Tanzen immer wieder auf die Nase. Das war drollig anzusehen. Es war ein lieber Bub.
Sie liefen Arm in Arm ins Bierstübel hinunter. Als sie im Winkel beieinander saßen, lachten und winkten ihnen alle zu, die vorüberkamen. Peterchen mußte über alles lachen, was der Kleine vorbrachte. Es kam so kurios bei ihm heraus. Und wenn sie ihm in die Augen sah, wurde er rot.
Sie stellten fest, daß er einen Monat jünger war wie sie; und dann ließen sie sich zusammen photographieren.
Alle Tänze tanzten sie miteinander. Und an den Tischen der Freunde bekamen sie aus einem Glase zu trinken und wurden Brüderlein und Schwesterlein genannt. Sie mußten sich feierlich und öffentlich einen Kuß geben. Dabei wurde wieder das Brüderlein rot.
Die großen Lichter loschen aus. Es spielte nur noch die Bauernkapelle. Man lag unter den Tannen am Boden. Brüderlein hatte seinen Kopf in Peterchens Schoß gelegt, und sie kraute und zauste sein dünnes seidiges Haar.
Dann zog auch die späte Kapelle ab, und man brach auf. In der Garderobe sah Peterchen den Fuhrmann, den Fremden, einer üppigen großen Dachauerin ihren eleganten Abendmantel um die Schultern legen. Er bemerkte Peterchen und nickte nachlässig und von ferne.
Sie kroch traurig in ihr Capes. Brüderlein begleitete sie und wunderte sich, daß sie nicht mehr so lustig war wie vorher. Sie ist wohl nur müde, meinte er und verabredete mit ihr ein Stelldichein im englischen Garten auf den nächsten Nachmittag. Im Torweg küßte er sie.
Kaum war Peterchen allein auf der Treppe, so kamen ihr die Tränen, und die kleine Wachskerze, die sie vor lauter Traurigkeit schief hielt, weinte mit.
Und weinend schlich sie in ihre Kammer, nahm die Tagdecke vom Diwan, und indem sie sich ihr Bett bereitete, fielen viele Tränen auf die Linnen.
Sie schlief erst ein, als es schon heller Tag war, und träumte von dem Fremden. Er hatte sie im Arm und auf den Knieen und sprach mit den anderen. Sie wartete immer, ob er sich nicht umwandte und ihr wieder so ganz frech einen Kuß gäbe mitten auf den Mund.
Und dann kams ihr vor, als stünden vorm Bett seine Lackschuhe, elegant und viel zu spitz, neben ihren Reformstiefeln (schier wie ein Naumburger ‚Gegenbeispiel‘ neben seinem ‚Beispiel‘). Aber als sie die Augen rieb war nichts dergleichen mehr da.
Peterchen drehte sich lebensmüde nach der Wand herum und verschlief den ganzen Nachmittag und das Rendezvous mit dem Brüderlein.
Gegen Abend klopfte es. Sie schrak auf: Das war er, der Fremde. Gewiß. Er kam, ihr Gewalt anzutun, kannte kein Mitleid.
Es klopfte noch einmal heftiger. Bebend schlich sie an die Tür: Brüderchen stand da mit einem Blumenstrauß.
Peterchen schlich ins Bett zurück. Er setzte sich zu ihr. Die Blumen lagerten auf der Bettdecke. Ihr war, als hätte er sie gepflückt im Garten, auf der Wiese. Und es wäre wieder Sommer und alles gut.
„Wer ist nicht zum Stilldichein gekommen?“ fragte das Brüderlein.
„Ich habs verschlafen, ach ich bin krank.“
War sie krank, so durfte er sie hegen und pflegen. Er verstand gelinde zu streicheln und die Tränen von den Wangen zu küssen. Er küßte sie zart auf Augen und Stirn, das arme Schwesterlein.
Und als sie immer noch ein wenig zitterte, legte sich Brüderlein zu ihr und bettete sie an seiner Brust.
Peterchen wurde müder und immer müder. Als sie aber die Augen schloß, fühlte sie wie der Fremde, der Gewaltige, auf ihr kniete und alles mit ihr tat was er wollte.
Und als sie die Augen wieder aufschlug, war das gute Brüderlein bei ihr und war so sanft, daß ihr wieder die Tränen kamen. Er sang ihr Kinderschlaflieder ins Ohr, bis sie eindämmerte. Dann stand er behutsam auf, deckte sie zu, ging an den Spirituskocher und kochte einen linden Tee für das arme Schwesterlein.
Bald war es eine ausgemachte Sache, daß die beiden zusammengehörten. Alle fanden sie sehr niedlich. Traf man ihn allein, so fragte man: Wo ist Peterchen? Lud man sie ein, so hieß es, ‚Sie bringen doch ihr Brüderlein mit?‘
Wir passen am Ende ganz gut zusammen, dachte Peterchen.
Auch für ihr Studium war Brüderlein gut. Er war schon weiter in der Malerei, schon bei den Finessen (und auf die kommt es in der Kunst an) und konnte ihr allerlei beibringen. Sie machte Fortschritte. Der Meister lobte sie.
Nun gingen die beiden auch nicht mehr ins Wirtshaus essen, sondern bereiteten ihre Mahlzeiten auf Peterchens Spirituskocher. Und während sie am Feuer stand, zeichnete sie Brüderlein. Und wollte sie ihn zeichnen, so kochte er.
Es ist am Ende doch gut für mich, das mit Brüderlein, dachte Peterchen.
Aber es dauerte nicht lange, so fühlte Peterchen sich recht unwohl. Und einmal wurde sie mitten im Abendakt ohnmächtig. Und in den ersten Frühlingstagen merkte sie, daß sie in der Hoffnung war, und bekam einen großen Schreck. Was werden die zu Hause sagen, wenn gegen Weihnachten statt der Tochter ein Brief ankommt: Ich krieg eben ein Kind, kann nicht heim reisen.
Drei Tage trug sie das Geheimnis still mit sich herum und hoffte immer noch auf eine Wendung des Geschicks. Als die aber ausblieb, sagte sie es eines Abends dem Brüderlein, der sich gerade auf ihrem Bett eine Hose flickte.
Brüderlein dachte einen Augenblick nach und die dünne Strähne fiel ihm auf die Nase. Dann blickte er auf und sagte: „Ja Peterchen, dann bekommen wir eben ein Kind. Das ist gut für dich und mich. Ich hab mir immer ein Kind gewünscht. Und ich sehe nicht ein, warum wir nicht ebensogut Kinder haben sollen wie die Bürger mit ihrer gesetzlich geschützten Liebe.“ Und dann setzte er ihr noch viel auseinander über die Frauen und daß alle Frauen Kinder haben müßten und womit das zusammenhinge. Und er meinte, wenn sie beide fleißig wären, würden sie schon für das Kind sorgen können, selbst wenn die Familie sie im Stiche ließe.
So redete Brüderlein, und weil er nichts von Heiraten und dergleichen sagte, so sagte Peterchen auch nichts davon. Denn das wäre gewiß abgeschmackt und bürgerlich gewesen.
Die nächste Zeit sprach er nun immerzu von dem Kind: Wie frei sie es erziehen wollten. Wie natürlich es aufwachsen würde. Wie sie ihm später ohne Prüderie sagen müßten, wie es entstanden wäre, und so weiter und so weiter. Und Brüderlein kaufte Bücher über Mutterschaft und las ihr daraus vor.
Und schließlich konnte sie nicht einen Augenblick mit ihm allein sein, so sprach er davon. Das wurde dem armen Peterchen zu viel, und sie lief oft zur Cora, um nur nicht Brüderleins Vorträge anhören zu müssen. Sie vertraute der Freundin das Geheimnis an.
Cora sagte, sie sollte sich nicht um Brüderlein kümmern, das Kind gehörte der Mutter. Und auf den Vater käme so gut wie nichts an. „Er muß in einem Moment, wo wir Frauen nicht selbständig handeln können, einsetzen. Und dann könnte er ebensogut verschwinden, sterben, wie so und so viele Tiermännchen in der Zoologie.“
Das gefiel Peterchen wohl. Als Brüderlein das nächste Mal wieder von dem ewigen Thema anfing, sagte sie, er sollte sich gefälligst nicht so wichtig machen mit seiner Vaterschaft. Und sie müßte jetzt viel allein sein: das wäre für sie und ihr Kind notwendig. Und sie wollte ein paar Monate allein aufs Land gehn.
Brüderlein hörte sanft zu, ehrte das Bedürfnis nach Einsamkeit und war mit allem einverstanden.
So fuhr sie denn eines Morgens mit Koffer, Staffelei und Malkasten nach Schleißheim. Sie mietete beim Schmied eine kleine Kammer, vor der ein Balkon mit Weinlaub war. Fleißig malte sie Birken, Torf und Bauernkinder. Und „Feld mit Bahnkörper“ und „Abend im Kiefernwalde“.
Abends wenn sie schlafen ging, war sie müde und ganz glücklich. Sie dachte an die Kunst und das freie Leben in der Sonne mit ihrem Kind. Aber wenn sie morgens aufwachte, war ihr oft zag zumut und sie dachte: Ich bin ein armes Mädchen und allein auf der Welt. Was soll aus mir und meinem Kinde werden? Und traurig schlich sie auf ihren Balkon und sah ins Wasser des Kanals hinunter.
Das Wasser ruhte in Morgensonne. Nur drüben am Wehr sprudelte es ein wenig. Blüten fielen von den Bäumen auf die Straße und das Gras. Die Schuluhr schlug. Die Kinder kamen gelaufen. Flachshaarige Buben tummelten sich. Die kleinen Mädchen saßen nieder ins Gras, streckten ihre braunen Beine ins Wasser und zupften Sternblumen.
Da dachte Peterchen an die eigene Kinderzeit, den Garten daheim und die Straßenjungen am Zaun. Und weiter an all die schlanken Sekundaner und Primaner, die ihr heimlich zusahen, wenn sie malte, und die jungen Leute aus dem Geschäft des Onkels, die ihr gern den Hof gemacht hätten, und an den Lehramtskandidaten zuletzt.
Und nun hatte sie die alle sehr lieb, und es tat ihr leid, daß sie hart gegen sie gewesen war. Aber sie sollten auch bedenken, wie schlecht es ihr seither gegangen mit dem bösen Fremden und dann mit dem Brüderlein, der nicht das große Erlebnis war, und jetzt mit dem Kind, mit dem Kind.
Unter so traurigen Umständen war es doch ganz erfreulich, daß Brüderlein alle Samstag heraus kam zu ihr. Er übernachtete in der Schloßwirtschaft und blieb bis Sonntag Abend. Nun redete er auch nicht mehr so viel von dem Kind, sondern gab nur hübsch auf Peterchen acht, daß sie ordentlich aß und sich Bewegung machte.
An solch einem Sonntag saßen sie beide im Garten vor der Schloßwirtschaft beim Abendbrot. Und während Brüderlein mit der Kellnerin sprach, schaute Peterchen über das Bosket auf die Münchner Chaussee. Da kamen drei Reiter geritten. Das war etwas Außergewöhnliches. Im allgemeinen gab es da nur die vielen Sonntagsradler zu sehen.
Die Reiter kamen näher. Und nun wurde auch Brüderlein aufmerksam, und so konnte er nicht bemerken, wie das Schwesterlein rot und blaß und wieder rot wurde.
Denn, der zur Rechten ritt, das war niemand anders als der Fremde. Er kannte Peterchen gleich und nickte ihr zu. Und als die Herren abstiegen und ihre Pferde dem Knecht übergaben, drehte er sich um und winkte mit der Hand, in der er Handschuh und Reitpeitsche hielt.
Das sah Brüderlein und fragte ganz verwundert: „Grüßt der dich? Kennst du den Herrn?“
„Ja.“
„Woher denn?“
„Auch vom Bauernball —“
Und ehe sie weiter erzählen konnte, kam der schreckliche Fremdling mit klirrenden Sporen an ihren Tisch, grüßte Brüderlein mit einer sehr vornehmen und minimalen Neigung des Kopfes und reichte Peterchen die Hand.
„Wie gehts? Sie auch hier draußen?“
Sie wohnte hier, antwortete sie ängstlich.
„Hier gibts wohl viel zu malen?“
„Ja,“ sagte Brüderlein und fing an, von Torf und Moos zu reden.
Aber der Fremde kümmerte sich nicht um ihn, sondern sagte zu Peterchen: „Na wenn Sie mal nach München kommen, müssen Sie mich besuchen, aber schreiben sie mir vorher ein Wort.“ Er reichte ihr seine Karte, machte dem Brüderlein die gleiche Verbeugung wie vorher und ging zu seinen Freunden ins Herrenstübchen.
„Das ist wohl ein Adliger,“ fragte Brüderlein, „er ist so elegant.“
Sie gab ihm die Visitenkarte und sagte mit matter Stimme: „Brüderlein, mir wird so schlecht, ich muß nach Hause.“
Er blickte sie erstaunt an, dann nahm er ihren Arm und führte sie heim. Sie konnte kaum gehen, so schwindlig war ihr.
Er legte sie zu Bett, gab ihr Medizinalwein, und als ihr etwas besser wurde, fragte er: „Wie ist das nur gekommen?“
„Ach ich habe mich so erschrocken, als er mit der Peitsche auf mich zukam.“
„Ja — aber er war doch ganz freundlich —“
„Er sah furchtbar aus, nicht wahr? Ach wir wollen nicht mehr von ihm sprechen.“
Das hielt auch Brüderlein für geraten. Aber ihr Zustand machte ihm Sorge. Wenn die kleinste Überraschung sie angriff, dann wars am besten, er zog zu ihr aufs Land.
Sie meinte erst, das täte wohl nicht not, und es wäre doch das einzige Mal, daß ihr so etwas zustieß. Aber er hatte ernstliche Bedenken und wollte lieber vorbeugen als abwarten.
Kurz: Am nächsten Tage packte er in München seine Siebensachen und mietete sich in Schleißheim beim Kaufmann ein.
Und es traf sich gut, daß er ganz nahe bei der Stelle, wo Peterchen ‚Feld mit Bahnkörper‘ malte, eine Baumgruppe zu malen fand, sodaß er von der Arbeit bisweilen nach ihr umschauen konnte. Und wenn sie einen Tag nicht wohl war, setzte er sich an ihr Bett und malte ‚Bildnisstudie‘.
Gab es Einkäufe zu machen, so mußte immer Brüderlein nach München fahren. Sie mochte nicht in die Stadt: Ihr war bang vor dem Fremden.
Aber einmal an einem heißen Julimorgen dachte sie an die schönen Pfirsiche in dem Obstladen am Münchner Hauptbahnhof. Sie konnte nicht abwarten, daß Brüderlein hinfuhr und ihr welche mitbrachte. Sie wollte gleich selbst hin. Brüderlein wußte aus seinen Büchern, daß Frauen in der Hoffnung solche Gelüste haben, und brachte sie auf die Bahn.
Unterwegs kam ihr der Fremde nicht aus dem Sinn. Sie hatte seine Visitenkarte in der Schoßtasche, öffnete von Zeit zu Zeit den Druckknopf und betrachtete das weiße Blatt:
Hermann Fahlmer
Heßstraße 20 Gartenhaus.
Aber dann stellte sie sich geschwind wieder die Pfirsiche im Korb vorm Laden vor, und das Wasser lief ihr im Munde zusammen.
Aus dem Bahnhof ging sie eilig in den Laden und kaufte ein. Aber kaum hatte sie zwei Pfirsiche verzehrt, so dachte sie nur mehr an den Fremden: Hermann war sein Vorname.
Sie ging in das vegetarische Restaurant, um Cora zu treffen, und den Nachmittag mit ihr zu verbringen. Als sie eintrat, war Cora schon fort.
Zwischen Wirsing und Auflauf beschloß sie, nachher zu ihr zu fahren. Cora wohnte in der Georgenstraße am freien Feld. Die Bahn zu ihr fuhr an der Heßstraße vorbei. Davor fürchtete sich Peterchen und ging vorerst in den Hofgarten Kaffee trinken. Sie las die Jugend und den Simplicissimus und in den Neuesten sämtliche Annoncen und sogar das Feuilleton. Von der Theatinerkirche schlug es vier.
Peterchen brach auf und stieg in den Tram. An der Pinakothek mußte sie umsteigen. Aber anstatt auf die korrespondierende Bahn zu warten, ging sie schnell und scheu die Heßstraße hinauf, schlich in das Haus Nr. 20, und ehe sie sich besann, hatte sie schon an der Tür des Fremden geschellt. Es dauerte eine Weile, dann wurde am Guckloch geschoben und er selbst machte ihr auf.
„Sie sind es. Das ist ja sehr erfreulich,“ sagte er und ließ sie eintreten. Er war ohne Jackett in einem gelbseidenen Hemd.
„Aber,“ fuhr er fort, indem er die Tür hinter ihr schloß, „warum haben Sie mir nicht geschrieben?“
Peterchen ließ den Kopf sinken.
„Ja sehen Sie, heut stehe ich nur eine halbe Stunde zu Ihrer Verfügung.“ Er bat sie, näher zu treten und führte sie in ein elegantes Studio. Unterm Schreibtisch lag ein weißhaariger Hund. Auf dem Anrichtetisch standen Kuchenschüsseln um ein Samovar.
„Sie erwarten Gäste,“ brachte Peterchen hervor, „ich störe —“
„Meine Gäste kommen erst um fünf. Wollen Sie nicht ablegen?“
Er legte ihr Jackett über eine Stuhllehne und betrachtete ihren nackten Hals. „Sie sind ordentlich braun gebrannt, Fräulein — wie heißen Sie doch?“
„Else,“ sagte sie, sie wollte Petersen sagen, aber es wurde Else.
„Die Arme auch so braun, Fräulein Else,“ fragte er, streifte ihren Ärmel langsam hoch und küßte sie auf den Ellbogen.
Peterchen seufzte. Er sagte: „Ja es ist wirklich schade, daß Sie mir nicht vorher geschrieben haben, Else. Warum haben Sie es denn nicht getan, Kind?“
„Ich konnte nicht.“
Er lächelte, setzte sich zu ihr auf den Diwan und küßte ihren Nacken. Dann stand er nervös auf und steckte sich eine Zigarette an.
„Sie sehen müde aus. Wollen Sie sich nicht ein wenig ausstrecken?“ Und er bettete sie sorgsam und schob ihr soviel Kissen unter, daß sie wieder Sehnsucht nach Pfirsichen bekam.
Seine Zigarette roch betäubend. Mit lässiger Hand spielte er an ihren Kleidern herum. Aber als er anfing, die Bluse zu öffnen, sagte sie: „Bitte fassen Sie mich nicht an!“
„Warum nicht?“
„Ich — bin nicht schön — — ich — bin schwanger.“
Da mußte Herr Fahlmer lachen, er nahm das ganze kleine Peterchen in die Arme, trugs im Zimmer herum und küßte es immer wieder und sagte: „So ein Kind, so ein Kind, und kriegt schon ein Kind!“
Eine halbe Minute lang war Peterchen sehr glücklich. Sie schloß die Augen, jetzt konnte er alles mit ihr tun, jetzt wollte sie gern sterben —.
Aber er trug sie auf den Diwan zurück und steckte sich eine neue Zigarette an.
„Freuen Sie sich denn auf Ihr Kind?“ fragte er.
Peterchen lag nun wieder auf den vielen weichen Kissen, und während ihr das Blut an die Schläfen pochte, sagte sie mit wichtiger Miene: „Es ist das einzige, was ich auf der Welt habe. Ich werde mein Kind sehr lieben. Frauen, die nicht Mütter werden, sind halbe Frauen —.“ Sie hätte noch weiter so reden können, allein sie bemerkte, daß er nach der Uhr sah. Ach Gott, er wartete ja auf die andere, auf die, die um fünf kam. Schnell stand Peterchen auf und sagte: „Ich muß nun gehen.“ Er brachte sie höflich an die Tür und bat sie bald wieder zu kommen. Auf der Treppe fürchtete und hoffte sie der andern zu begegnen. Aber es kam nur ein Milchjunge vorbei.
An der Bahn kaufte sie sich wieder ein paar Pfirsiche und aß sie traurig während der Heimfahrt. „Nun habe ich nur noch mein Kind,“ sagte sie sich mit leiser Stimme vor, wie eine Schauspielerin, die ihre Rolle lernt.
In Schleißheim ging sie nicht zuerst zu Brüderlein, sondern gleich nach Haus und zu Bett. Und als er zu ihr kam, drehte sie sich nach der Wand um und sagte: „Bitte laß mich schlafen.“ — Brüderlein ging diskret in den Mondschein hinaus.
Von diesem Tage an fuhr Peterchen nie mehr in die Stadt. Sie lag den ganzen Tag im Birkenwäldchen zwischen den Halmen des abgeblühten Grases. Zum Malen war sie viel zu müde. Wenn Brüderlein kam, nach ihr zu sehen, schickte sie ihn immer bald wieder fort. Jetzt war sie gern allein. Das Moos roch so stark. Oft glaubte sie Hufschlag zu hören. Reiter reiten vorbei, dachte sie. Dann wieder meinte sie, in ihrem Schoß schon den leisen Herzschlag zu vernehmen.
Cora kam bisweilen heraus und lag mit ihr unter den Birken. Sie nahm Peterchen auf die Kniee, flocht ihr die braunen Zöpfe auf und machte ihr allerlei neue Frisuren. Und wenn die kleine Jungfer-Mutter sich zärtlich an sie schmiegte, kam sie sich schier vor wie St. Anna selbdritt.
So vergingen die Sommertage ganz glücklich. Nur in den Nächten hatte Peterchen oft Kummer. Sie träumte schlimme Träume von vielen kleinen Kinderleichen, die rings um sie lagen. Wenn sie dann aus dem Schlaf auffuhr, kam das graue Kätzchen des Schmiedes, das jede Nacht in ihre Kammer schlich, zu ihr ins Bett.
Und weil Peterchen es sehr lieb hatte, schenkte ihrs der Schmied zum Andenken, als sie im Herbst in die Stadt heimkehrte.
Nun wohnte sie wieder in ihrem kleinen Atelier. Das Kätzchen saß im Fenster, blinzelte in die Sonne und musizierte im Mond.
Sie sollte täglich spazieren gehen, hatte der Arzt verordnet. Darum holte Cora sie nachmittags ab, und die beiden Freundinnen schritten langsam die Vorstadtstraße hinauf. Vor den Spezereiläden blieben sie stehen und an den Zäunen der Krautgärten. Der Landschuhmacher nickte ihnen zu aus seinem Fenster und die Rentamtmannswitwe Merkl unter ihrer Sonnenblume.
Dann kamen sie auf den Feldweg und hinauf zum Wehr an der Schwaige. Dorfkinder spielten im Wasser und zogen ihre Schiffe.
Die beiden Mädchen setzten sich unter die Bäume des Wirtsgartens, fütterten die Hühner und neckten den großen Truthahn, bis er kollerte und mit den Flügeln den Boden kratzte. Und die Gänse wackelten vorbei und gackerten. Sie kamen Peterchen vor wie Frauen, die schon viele Kinder gekriegt haben und denen das alles nichts Neues mehr ist.
Abends auf dem Heimweg begegnete ihnen oft eine schwangere Bürgersfrau. Die sah Peterchen groß ins Gesicht. Und einmal redete sie sie an. Cora stand verlegen daneben. Und als Peterchen nach ihr umsah, bemerkte sie Tränen in ihren Augen.
„Was hast du, Cora?“
„— Ach nichts —“
„Warum weinst du?“
„Ach liebes Peterchen,“ sagte Cora und küßte sie.
Peterchen mußte mit zu ihr und die Nacht bei ihr bleiben. Cora weinte an ihrer Brust: „Ihr, ihr habt doch wenigstens das Leben.“ Sie wurde immer zärtlicher und bekam rote Flecken auf den Wangen. Das gefiel Peterchen gar nicht. Sie schlich früh fort, während die andere noch schlief.
Doch auch zu Hause wurde sie nicht lang allein gelassen. Brüderlein kam mit Blumen. Er war in gedrückter Stimmung. Gestern hatte er kein Licht bei ihr gesehen. Aber er wagte nichts zu sagen und ging bald wieder fort in die Pinakothek, kopieren, um Geld zu verdienen.
Peterchen dachte nun auch viel an die Zukunft und ans Verdienen. Sie bekam durch den Meister Empfehlungen und Aufträge und zeichnete Plakate auf dem kleinen Pult am Fenster.
In den ersten Oktobertagen entwarf sie zu wiederholten Malen den Brief, den sie demnächst nach Hause schreiben mußte. Sie wollte darin ihr Recht auf freie Mutterschaft betonen und erklären, daß sie sich wohl imstande fühlte, selbst für sich und ihr Kind zu arbeiten, wenn man ihr etwa die Mittel verweigerte. Um Mitleid und Gnade brauchte sie nicht zu bitten.
Sie war auf alles gefaßt, und der Gedanke an Sorge und Arbeit tat ihr wohl.
Aber es kam anders, als sie erwartet hatte. Nach den milden Herbsttagen gab es auf einmal Sturm. Mitten in der Nacht wurde Peterchen von großen Schmerzen wach. Am Morgen kam der Arzt und machte ein besorgtes Gesicht. Es waren noch keine sieben Monate. Peterchen lag zwei Tage lang in Fieberphantasien: Sie hatten sie zu Hause eingesperrt. Onkel Ferdinand hielt an der Tür Wache und besah, um die Zeit zu verbringen, ein Album Meisterwerke der Malerei. Sie aber wartete am Fenster auf den Fremden, der kommen mußte, sie zu erretten — —. So oft die Wehen kamen hörte sie Hufschlag.
Und dann an einem Regenmorgen bekam sie ein winziges Kind. Es atmete kaum. Es war ein Mädchen. Die Hebamme gab Brüderlein ein Läppchen mit Zuckerseim. Das sollte er dem Kind um den Mund streichen. Er saß den ganzen Tag vor den beiden Kissen, auf die das neue Geschöpf gebettet war und fuhr ihm vorsichtig mit dem Lebensläppchen über die Lippen. Peterchen sah ihm von ihrem Schmerzensbett zu. Und hatte ihn recht lieb, zum ersten und letzten Mal. Sie war so schwach. Sie wollte aber doch wach bleiben. Sonst stirbt das Kind, dachte sie. Allein sie konnte die Augen nicht aufbehalten.
Als sie erwachte, war das Kind schon fort. Sie weinte, weil man es ihr nicht mehr zeigen wollte und bekam Schlafmittel, die sie wieder einwiegten.
In der nächsten Zeit war der Arzt sehr zufrieden mit ihrem Zustand. Aber Peterchen war kaum ein wenig zu Kräften gekommen, so wurde sie recht unglücklich. Denn nun war sie bis zum Dezember sicher wieder ganz gesund und konnte ruhig nach Hause fahren. Umsonst hatte sie den schönen mutigen Brief entworfen. Nun hatte sie nicht einmal ein Frauenschicksal.
Eigentlich blieb ihr nichts übrig, als eine große Künstlerin zu werden. Sobald sie wieder aufstehn konnte, ging sie in die Malschule und malte etwas wilder und nicht mehr so genau. Aber der Meister machte ihr Vorwürfe und erinnerte sie an ihre früheren Arbeiten, die so ‚sauber ausgeführt‘ waren.
Dem Brüderlein ging Peterchens Schwermut zu Herzen. Er sann und sann, ob es da keine Hilfe gäbe. Und schließlich glaubte er es gefunden zu haben, kam zu ihr und sagte: „Peterchen, wollen wir heiraten?“
Sie sah ihn verwundert an: „Warum denn?“
Die Strähne fiel ihm auf die Nase und er meinte: „Ich dachte, dann bekommen wir am Ende ein richtiges Kind.“
Da lachte Peterchen zum ersten Mal seit langer Zeit und schickte ihn fort. Und schrieb noch denselben Abend an den Fremden, der sich während ihres Wochenbetts nach ihrem Befinden erkundigt hatte. Sie lud ihn zum Tee ein.
Herr Fahlmer erschien im Gehrock und hatte ein riesiges Rosenbukett in der Hand. Er sah sich nach einem Platz dafür um und legte es schließlich auf den Kochofen neben das Mundglas, in dem Peterchens kleine Zahnbürste stak.
Sie lud ihn ein, Platz zu nehmen. Er betrachtete die Sitzgelegenheiten. Auf allen lagen Gegenstände. Blieb nur das Bett übrig. Er zog es vor, herum zu gehen, und ihre Skizzen zu betrachten. Sie konnte ihn dabei über allerlei belehren. Denn von Malerei verstand er nichts.
Aber ihm wars zu eng im Raum. Und als er seine Tasse ausgetrunken hatte, schlug er vor: „Wollen wir nicht ein bißchen spazieren fahren? es ist so schönes klares Wetter.“
Nun hatte Peterchen nichts Rechtes anzuziehen. Sie bastelte verschämt an allerlei Fetzen herum, nähte an einem grünen Rock, stopfte an einer lila Bluse. Die war eigentlich zu dünn, aber sie hatte nichts Besseres. Dann garnierte sie geschwind einen Hut. Und als der keine rechte Form annehmen wollte, langte Herr Fahlmer zwei Seidenbänder aus der Schublade und wand sie ihr so um Krempe und Kinn, daß etwas wie eine Babykapuze daraus wurde. Um den Hals legte sie eine Muschelkette. Sie wollte erst eine aus bunten Steinen nehmen. Aber der Fremde, der ja nichts von Kunst verstand, meinte, die Muscheln gingen noch eher.
Über diesen Zurüstungen war es gegen sieben Uhr geworden. Und als ihr Wagen in den englischen Garten kam, war schon Nacht unter den Bäumen. Hinter dem Kleinhesseloher See küßte der Fremde sie auf den Mund; worauf sie an seine Brust sank und längere Zeit in dieser Stellung verharrte, was er ritterlich ertrug.
Sie fuhren in die Stadt zurück und hielten vor der Bar. Daselbst speiste der Fremde Peterchen reichlich mit guten Dingen als: Mocturtlesuppe, Hummer, Spargel. Anfangs genierte sie sich ein wenig, dann langte sie brav zu. Er betrachtete sie gerührt und etwas gönnerhaft.
Nach dem Tischwein ließ er einen herben Sekt kommen. Von dem wurde ihr eigen zumute: Gar nicht verschwommen, wie sie gefürchtet hatte, sondern so, daß sie ‚ihr ganzes Leben klar übersah,‘ wie sie sich ausdrückte: Ja, sie hatte das Brüderlein nur um des Kindes willen geliebt. Nun war sie frei. Nun wollte sie keine Hilfskonstruktionen mehr machen. Sie wollte das Leben selber leben.
„Was ist denn das, das Leben selber?“ fragte der Fremde.
Wußte er es auch nicht? Peterchen senkte traurig den Kopf und trank mit Tränen das Sektglas leer.
Die Unterhaltung stockte. Schweigend sah sie ihm zu, wie er aus einer Saffiantasche eine gewaltige Havanna holte und dazu einen silbernen Apparat, mit dem seine gepflegten Hände ein Loch in die Zigarre bohrten. —
Und wieder saßen sie in einem Wagen. Und als er sie fester in seine Arme schloß, sagte Peterchen:
„Sie können das vielleicht nicht verstehen. Aber ich, ich habe immer so viel Sehnsucht nach dem Leben gehabt. Als ich ein kleines Kind war, gingen die älteren Schwestern mit mir zum Jahrmarkt vor die Stadt. Sie würfelten in den Buden und kauften Näschereien. Da war auch eine bunte Bude, in der wurde Theater gespielt. Der Eintritt kostete fünfzig Pfennig, und so viel hatten wir nicht. Da gingen wir immer hinten herum an den Zaun und sahen durch die Ritze: Da sah man ein bißchen von den Schauspielern und die Musik konnte man ganz hören. Das nannten wir: Plankenbillett —.“
Peterchen schluchzte und konnte nicht weiter erzählen. Er versuchte sie zu trösten. Als der Wagen vor ihrem Haus hielt, wollte er ihn weiter fahren lassen zu sich: So konnte er sie doch nicht allein lassen — und außerdem war sie wirklich sehr niedlich.
Aber Peterchen schüttelte energisch den Kopf, stieg aus und ging Tränen trocknend ihre vier Stiegen allein hinauf.
Als sie nun in ihrem Zimmer stand und bei Kerzenschein den Eukalyptuszweig über ihrem Bett sah und das grüne Tuch vorm Schrank und den Rupfen dahinter und den guten verdrossenen Beethoven an der anderen Wand und das Kätzchen auf dem Fensterbrett im Mond, da wurde ihr mit einmal gut ums Herz. Sie verteilte die frischen Rosen in allerlei Gläser und Vasen, hing ihre Muschelkette an den Nagel, steckte den Spirituskocher an und sah still in die blaue Flamme.
Und seitdem ist Peterchen anders geworden.
Sie pflegt ihre Blumen. Im Sommer schwimmen Moosgeflechte und Feldblüten in ihrer Waschschüssel. Und das Zimmer duftet wie eine Wiese am Wasser. Im Winter hat sie Zweige mit roten Beeren in den Gläsern, Mimosen und welke Herbstblätter; und es riecht nach Mandarinenschalen.
Wenn es sehr kalt ist und der kleine Ofen nicht mehr genug heizt und draußen die Wasserleitung einfriert, dann ist Peterchen freilich traurig und krümmt sich in Decken und Mäntel gewickelt auf ihrem Schlafdiwan.
Aber am Nachmittag kommen Gäste. Dann wirds wärmer. Man trinkt Tee und ißt Kuchen mit Schubladengeschmack.
Mit Peterchens Kunst geht es auch ganz gut weiter. Sie macht jedes Jahr einen kleinen Fortschritt, hat bereits zweimal ausgestellt und ein Porträt verkauft.
Ob sie inzwischen das Leben selber erfahren hat, ja, das weiß ich nicht.
Lieber Eduard!
Es ist nun höchste Zeit, daß Du es erfährst. Wie oft wollte ich es Dir sagen und konnte nicht. Du mußt es wissen. Ich will Dirs schreiben. Es ist vielleicht gemein, daß ich erst jetzt spreche. Aber Du selbst bist schuld, daß ich es bisher nicht konnte.
Als wir uns zum ersten Mal sahen auf dem Sommerfest vor drei Jahren, sagtest Du, ich sähe einem flachshaarigen Kinde ähnlich, das unter Deinem Fenster mit seinen Gespielen immer Ringelreihen tanzte. Dies Kind, das ich nie gesehen habe, hat mir Gewalt angetan. Seit Du mich ansiehst, bin ich so ‚rührend‘ so ‚töricht‘. Das Kind ist nun in mir. Ich selbst? — Nein, glaube nicht, daß ich Dir Komödie vorgespielt habe. Ich konnte nicht anders, es war mir ganz natürlich. Verstehst Du das?
Du bist edel, ich liebe Dich, ich werde Dir immer für alles dankbar sein, auch wenn Du mich jetzt vielleicht verläßt. Du hast mich geschont wie ein krankes Tier. Du hast nie meine Schwäche ausgenutzt und bist doch ein Mann. Aus all dem Zufall von Worten, Kleidern, Mienen, Frisuren, Gedanken, Gebärden, aus all meinem Gestern und Heute hast Du ein Ding gemacht. Und das — bin ich. Bevor ich so war, gab es mich gar nicht. Vielleicht habe ich vorher nur in Deinem eigensinnigen Schädel gesessen.
Du, kein Verführer kann so Gewalt antun wie Du Tugendhafter. Keine Mutter kann so über ihr Kind wachen. Und ich liebe Dich für diese Gewalt, aber — ach Liebster ich darf Dir keinen Vorwurf machen. Es gibt nichts Köstlicheres im Himmel und auf Erden als Deinen Handkuß. Aber nun kommt das, was vielleicht nur Zufall war; und mir ist so furchtbar bange, daß Du es nicht verstehst. Und verstehst Dus nicht, dann ist alles aus, dann muß ich fortgehen von Dir.
Zufall vielleicht — oder doch was anders. Du hast mir von den keuschen Frauen der Stadt Babylon erzählt, die einmal im Tempel der Göttin sich preisgeben mußten dem, der irgend woher kam. An diesen Tempel habe ich oft gedacht. Vergib mir Liebster. — Nun muß ich erzählen.
Es war im zweiten Jahre unserer Bekanntschaft am Fastnachtdienstag, Du trugst eine blaugraue Mönchskutte, in der alle Deine Bewegungen lang und gelassen waren. Aber bald wurdest Du nervös, hastig, Deine Hand tat mir weh, Dein Kuß machte meine Lippen bluten. Du hast später manchmal von dieser Nacht gesprochen und gesagt, ich wäre damals anders gewesen als sonst, böser, verführerischer.
Ich trug ein grünseidenes Sommerkleid, ein Erbstück aus dem Schrank der Großmutter. Du meintest, es wäre die altertümliche Farbe, die so seltsam wirkte zu meinem Hals und Haar. ‚Du bist so fern und viel zu nah‘, sagtest Du. Das Kleid war übrigens für Krinoline gearbeitet und machte mir Hüften. Mir war etwas ängstlich zumut in dieser Seide, die meine natürliche Gestalt veränderte. Alle Blicke, die meine Taille streiften, taten mir weh.
Um Mitternacht wolltest Du fort vom Fest. Du batest mich, Dich nicht allein zu lassen. Wir fuhren zu Dir. Du gabst mir Dein Schlafzimmer, und als ich im Bett lag, kamst Du herein und setztest Dich zu mir, um mich in Schlaf zu schwätzen, was Du so gut kannst. Aber Du warst nicht ruhig wie sonst. Deine Blicke waren voll Fieber. Dann knietest Du, und legtest Deinen Kopf in meinen Schoß. Deine Schultern zuckten vor Schmerz. Du tatest mir leid, wie ein Kind der Mutter leid tut. Ich streichelte Dein Haar. Aber da richtetest Du Dich auf, sahst mir ins Auge und fragtest: ‚Olga, hast Du nicht einmal zu mir gesagt: Dir kann man ganz vertrauen? Ist das noch wahr? Kann man mir noch vertrauen?‘ Ich zog Dich in meine Arme und küßte Deine Stirn — und dann gingst Du ins Wohnzimmer hinüber.
Die Kerze brannte noch und gab so liebes Licht. Das grüne Kleid lag auf dem Stuhl in grotesken Falten. Wie lauter Hüften waren die Falten. Ich konnte nicht schlafen. — Leise stand ich auf. Ich mochte Dich nicht wecken Du armer Lieber — nein, mir war bange vor Deinem Erwachen, ich wollte davon und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Daß er nur nicht erwacht, dachte ich, zog lautlos das Kleid an und schlich fort.
Ich bin ja oft in der Nacht allein nach Hause gegangen. Mein Gott, in München braucht man sich nicht zu fürchten. In dieser Nacht fürchtete ich mich und wollte erst den kürzeren Weg über Feld vermeiden und lieber in den Straßen bleiben. Aber dann schämte ich mich meiner Furcht und ging mir selbst zum Trotz auf die Wiese.
Mit einmal tat was Grelles meinen Augen weh: Es war das Azetylenlicht einer Radlaterne. Unheimlich langsam kam es näher, den Fußpfad herauf. Ich verließ den Weg und ging über Gras und Geröll, um dem, der da kam, nicht gerade vors Rad zu laufen. Mit einmal stand er vor mir. Die Lampe blendete mich. Ich konnte nicht von der Stelle.
„Wohin?“ fragte er, dessen Gesicht ich nicht sehen konnte. „Ich muß aufs Fest zurück,“ sagte ich hastig. Warum ich das sagte, weiß ich nicht.
Er lachte schrecklich: „Unsinn, es ist Aschermittwoch. Du kannst wohl nicht schlafen?“
Woher wußte er das?
Er faßte mit der Linken nach meinem Handgelenk. Mit der Rechten dreht er das Rad so, daß das Licht mich grell bestrahlte. Mein Mantel klaffte: Er sah mein Festkleid. „Verrückte Mode,“ sagte er. Die Trivialität seiner Sprache machte mich schwach. „Komm,“ sagte er, „wir gehen aufs Fest.“
Nun war ich an seiner Seite, sah sein knochiges unangenehmes Profil mit der niedrigen Stirn, den kleinen tiefliegenden Augen. Nur seine Nase war edel. Und da, wo sie in der Stirn wurzelte, war viel Gewalt.
„Lassen Sie mich los,“ rief ich, „ich werde um Hilfe schrein.“
„Warum?“ fragte er und faßte mein Gelenk fester.
Ich schluchzte. Die Stimme versagte mir wie in einem Traum.
Liebster, ich weiß nicht wie das kam: Ich lief an seiner Hand wie ein Kind, das man mitzieht. Er stieg eine Treppe hinauf in einem Haus, das Rad links und mich rechts. Er stieß eine Tür mit dem Fuß auf, nahm die Lampe vom Rad und stellte sie auf den Schemel. Auf einer Matratze am Boden lag ich. Die Laterne stach mir in die Augen, in die Brust. „Das Licht tut so weh. Hast du keine Kerze?“ — „Nein, mach doch die Augen zu —.“
Ein furchtbarer Gasgeruch drang auf mich ein. Mir war als strömte mein Leben aus, aus einem Gashahn, den eine dumme Magd in der Küche aufgelassen hat.
Und dann stand er auf, ging an sein Rad und pumpte den Reifen auf. Die Tränen stürzten mir aus den Augen. Ich konnte mich nicht regen. Da drehte er sich um und machte ein gutmütiges Gesicht, eine Grimasse von Mitleid. Das gab mir Kraft. Ich stand auf, ich lief, ich war im Freien —.
Ich jagte durch die Nacht zu Dir zurück. Sacht schlich ich ins Schlafzimmer und warf die Kleider ab. Die Kerze brannte noch. Die Tür war angelehnt. Ich öffnete und kam im Hemd an Dein Lager. Du, ich hatte einen sehr schlimmen Gedanken. Aber da lagst Du so still, so gut. Ich hätte Deine Füße küssen mögen, baden mit meinen Tränen, mit meinen Haaren trocknen. Ach ich bin schlecht, Du Unschuldiger. Aber was sollte ich tun?
Ich lag still im Bett und überlegte, wie ich Dir morgen alles erzählen wollte. Als die Sonne aufging, kamst Du herein, Du warst frisch und schön im Morgen. Du nahmst meine Hand, küßtest sie und sagtest: „Olga, verzeih mir das von gestern. Vertrau mir wieder ganz.“ — Du hast Dich gewundert damals, daß ich so wild weinen mußte. Verstehst Du nun? Verstehst Du, daß ich Dir nichts sagen konnte?
Du bist so gut, Du weißt für alles, was mit mir geschieht, nachher immer eine Erklärung. Am Ende sagst Du nun, ich hätte nicht gewußt, was ich tat. Mir wäre einfach Gewalt geschehen. — Eduard, wenn ich Dir nun noch eins sage, kannst Du mich dann noch lieben? Wenn er, der andere, auf der Wiese meinen Arm wieder los gelassen hätte, ach Gott, ich wäre ihm nachgelaufen, glaub ich, wie das Kalb zur Schlachtbank. Verstehst Du das, Lieber? Kannst Du mich noch lieben?
Olga.
Buchdruckerei Roitzsch, Albert Schulze, Roitzsch.
Der Originaltext erschien in einer Frakturtype.
Einige wenige orthografische Fehler wurden berichtigt.
The book was originally published in Fraktur typeface.
A few typographical errors have been corrected.
[The end of Laura Wunderl, by Franz Hessel]